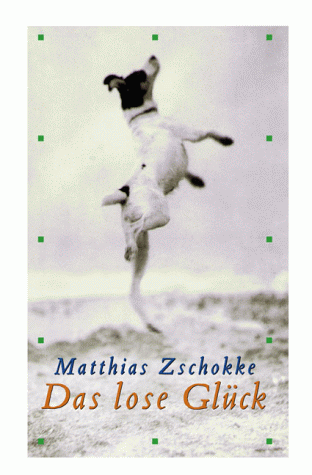
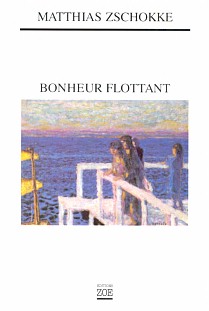
Auch wenn es nicht von A nach B geht, kann Literatur
spannend sein. Ein paar Menschen im Boot. Stille See.
Langeweile. Aber gewaltige Satzeskapaden treiben wie
gigantische Wogen an die Bootswand. Das ist Zschokke,
einer, der die Worte als Atem zum Leben braucht.
Als er im November 1996 den Aargauer Literaturpreis erhielt, ehrte die Jury diesen
Berner und Berliner mit Aarauer und Gontenschwiler Heimatbrief für ein
vielseitiges Werk, das geprägt sei von "unverwechselbarem Klang", ein Werk, das
von einer spielerischen Heiterkeit zeuge, die nie darüber hinweg täusche, dass am
Abgrund unserer Gegenwart getanzt werde. Getanzt mit Worten wird in
Zschokkes Werk noch immer. Und thematisch schäkert er im schönsten Dialog und
Erzählton mit seinen Figuren und mit seinem Publikum. Er bittet zum Wörtertanz und
verschweigt auch nicht, dass er den Totentanz meint. "Das lose Glück" treibt hier
bei leichtem Wellengang wie ein Papierschiffchen im Wasser. Strandgut, das
niemand beachtet, das mal hier, mal dort am Ufer anlegt und Worte und Gedanken
fallen lässt, zurück lässt.
Das Buch aus dem Ammann-Verlag ist der Reihe "Meridiane" zugeordnet. Der
Meridian, das ist der Kreis der Himmelskugel. Zschokkes Meridiane kreisen ums
Leben, das seine Buchgestalten scheinbar federleicht wegzugeben bereit sind.
Oder, um näher an die Sache zu kommen: seine Menschen auf dem Schiff haben
eigentlich alle nichts mehr zu verlieren am Leben. Feierabend ist ihr hübschestes
Geräusch. "Wir sitzen auf diesem Schiff aus einem einzigen Grund: wir wollen in
Ruhe gelassen werden, schweigen."
Vier Freunde sind es also, die das Wochenende regelmässig auf der Yacht einer
skurrilen, mit Altersdepressionen beladenen Frau namens Tana verbringen. Dann,
an einem Wochenende, an dem die Freunde wie an allen Wochenenden zusammen
sind und auf Godot oder sonst ein Wunder warten, taucht aus der einbrechenden
Dunkelheit eine Schwimmerin auf, die, schon etwas unterkühlt, um Aufnahme
bittet. Die Freunde ziehen die nackte Frau aus dem Wasser, bergen das Opfer, das
nun als therapiertes Wesen zum Märtyrium der andern seine nicht enden wollende,
aber von wohliger Langeweile strotzende Lebensgeschichte ausbreitet. Aber die
Rettung aufs Boot entwickelt sich auch für Ella, die Schwimmerin, zu einer Art
Dürrenmatt'scher Panne. Ihr äusserliches Nacktsein ist eins, nun aber wird sie von
den Freunden auch noch innerlich ganz und gar entblösst. Dass sich dann im
Laufe der Schiffsfahrt aus einer Pistole ein Schuss löst, dass jemand wirklich sein
Leben lassen muss, ist dramaturgisch gesehen ein einsamer Höhepunkt im
Geflecht dieser die Schreibe umrankenden Reflexionen. Sonst lächelt die See.
Schuberts "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus" liegt
gespenstisch über der Stille des dahintreibenden Bootes.
Menschen, Freunde, Phantasten. "Gerupfte Hühner, die nicht wissen, dass sie
sterben, die ganz und gar damit beschäftigt sind, Hühner zu sein, sich in den Sand
zu hocken, wieder aufzustehen, das Gleichgewicht zu halten, ausgelastet mit den
Schwierigkeiten pickend über einen Hof zu schreiten, vogelfrei, im losen Glück."
Zschokkes Protagonisten sind Sonderlinge, das ohne Zweifel. Aber sie tragen die
Schuhe, die wir auch tragen, und sie spielen mit den Gedanken, die auch in uns
wohnen. Sie morden hier, lachen dort. Leiden an allem und lieben, wo es nach
Liebe ausschaut. Sie wissen um das aktive Leben, das von den treibenden
Kräften einer Gesellschaft geschätzt und propagiert wird.
Tana, die Besitzerin des Bootes, ist vermögend, was ihr Leiden am Altern
keineswegs mindert. Samuel ist ein renommierter Anwalt mit hoher Klientschaft,
der phlegmatisch Unlust und Trägheit verströmend das Geschwätz im
Dämmerschlaf miterlebt. Portmann ist Forstingenieur und Linus hat eigentlich als
Mädchen angefangen, als Lina. Lina wollte Sängerin werden. Und hier nun
begegnen wir wieder, wie auf so manchen Schauplätzen dieses fast 300 Seiten
zählenden Werkes, diesem komödiantischen Reiz, dieser Heiterkeit, die den Autor
als hochbegabten Situationskomiker auszeichnet, als Schauspieler eben. So
könnte etwa die Schilderung von Linas Gesangsstunden als eine herrliche
Groteske auf dem Theater begeistern. Komisches fliesst in Tragikomisches. Sätze,
die herausfordern, weil wir Leser verunsichert sind, ob hier einer mit uns oder mit
seinen Figuren Schabernack treibt, oder ob Zuhören tatsächlich im gleichen
Augenblick so schön wie mühsam sein kann. Worte um nichts. Worte in den
Seewind geschrieben. Aber keines soll untergehen, keines soll unnütz verklingen.
So hielt es auch Beckett.
Zschokkes neues Buch ist kein Roman, ist keine Erzählung, wird aber in anderer
Form ohne Zweifel früher oder später als Theaterstück auf die Bühne kommen.
Gedankensplitter, chaotisches, sprunghaftes Erzählen und Parlieren, ein
sprachlicher Marathonlauf, den nur bestehen kann, wer Literatur pur liebt, wer
dem Plaudern eines neurotischen Beobachters folgen mag. Mehr will dieses Buch
nicht. Provokation ist beigemischt, sehr viel Humor bläht die Segel, und mit seiner
aberwitzigen Dialog- und Situationskomik bereichert, erinnert das alles an
Zschokkes frühere Werke, an "Der dicke Dichter" oder an "Max", den Erstling, für
den er schon 1981 den Robert-Walser-Preis bekam. Manches will auch zu jenem
andern Schreiber passen, den Matthias Zschokke verwandtschaftlich bedingt in
seinem Gepäck mitschleppt, zu Heinrich Zschokke, dem Schriftsteller und
Staatsmann, der an der Blumenhalde in Aarau wohnte und als "Schweizer Bote"
und "Hansdampf in allen Gassen" einstmals eine grosse Leserschaft hatte.
Matthias Zschokke scheut sich auch keineswegs, mundartliche Floskeln
einzubringen, was es schwer macht, das Erzählte geografisch zu orten. Die
Zertrümmerung des Phänotyps "Roman" lässt ihn kalt, dafür strömt übers ganze
Buch weg eine feine Walser'sche Sprachmelodie. Wie die Kleinbürger bei jenem -
offensichtlich grossen Vorbild des Autors - permanent Selbstbewusstsein
erkämpfen, schafft Zschokke mit seinen Bootsfreunden bewusst keine ironischen
Helden.
Da gibt es im Buch Stellen, wo man tatsächlich meint, sich plötzlich in Simon
Tanners Welt zu finden. Man hat Walser einen Chronisten des Alltags genannt, und
was finden wir hier? Ist es nicht die Stimme von Simon Tanner, die hier in
Zschokkes Werk spricht: "Jeden Tag um fünf Uhr gehen Frauen draussen im
Treppenhaus an meiner Bürotür vorüber und freuen sich auf den Feierabend. Das
ist ein hübsches Geräusch. - Ist es euch auch schon aufgefallen, wie miserabel
man zur Zeit in unseren Gaststätten kocht? Mir ist jede Lust vergangen, mich mit
meinen Klienten zum Essen zu verabreden. Das sage ich nur, weil ihr mir immer
vorwerft, ich würde mich an der Unterhaltung nicht beteiligen. Wahr ist, dass ich
oft erschöpft bin und in Gedanken versinke, während ich weich geschaukelt
werde von deiner Yacht, Tana. Das leise Klatschen der Wellen lullt mich ein. Was
für ein schöner Sommerabend heute . . ."
Zschokke kehrt immer wieder fast besessen zum Thema der Niederlage zurück.
Die Altersfreundschaft ist angesprochen und mit ihr die Einsamkeit. Resignation ist
spürbar, treibt auf sachten Wellen dahin. Was für eine Wahrheit, die Zschokke hier
zwischen den Zeilen mitführt. Wörter treiben wie Schaumkronen in eine Dimension
der Zeitlosigkeit, beleben diese Sprache, mit der ausufernd deklamiert und
argumentiert wird. Und wenn der Autor auch bewusst die gängige epische
Struktur in seiner Prosa auflöst, so beherrscht er seinen Stil meisterhaft. Diese
Menschen, die er uns vorführt, und deren Glück wahrlich nur noch ein loses ist,
scheinen fest entschlossen, "normales" Reagieren auf das, was wir moralisches
Verhalten oder gesundes Denken nennen könnten, über Bord zu werfen. Denn im
Grunde genommen ist Zschokkes Gesellschaft eine ziemlich dekadente, und seine
Figuren sind auch Theaterfiguren, das ist halt durchs Band weg spürbar.
Und doch: Diese Prosa ist wirr und verwirrend und ohne Ziel - aber sie packt, nur
literarische Nichtschwimmer werden darin den Boden verlieren.
("Aargauer Zeitung", 25.8.1999)

Da schreibt einer, klammheimlich in seinem Berliner Versteck, ein grosses
lockeres Buch, das nichts als Vergnügen bereitet, eine intellektuelle
Herausforderung zwar, aber doch ein lockeres grosses Leseglück. Das Buch
heisst: «Das lose Glück». Das Lose ist das Thema. Auf der ganzen Linie und
aus verschiedenen Blickwinkeln.
Das Lockere, das Entknotete, Aufgeweichte, Entkrampfte, Entbundene, das
Mutwillige: das wären so Namen für dieses Lose, das sich dem Leser
unmittelbar mitteilt, körperlich. Das Buch tut diese Wirkung dank der
fliessenden, fast magischen Durchsichtigkeit seiner Komposition, dank der
Schmiegsamkeit der Sätze, der melancholischen Leichtfüssigkeit der Figuren,
dem Hintersinn ihrer Monologe, ihrer schwebenden kauzigen Reden ans Dasein.
Matthias Zschokke ist ein Philosoph und als solcher ein hinreissender
Erzähler. Wir hätten keine Zeit vor dem Tod, die Spatzen zirpen's von den
Dächern. Wie aber gewinnen wir Zeit vor dem Tod, fragt der Autor mit jedem
Wort und mit jeder Gestalt. Weder mit dem besonderen Ereignis, den Reisen
und Abenteuern, noch mit dem interessanten Job, wohl aber mit dem Wahrnehmen
des Moments. Das schafft Zeit.
Sechs Personen suchen sie, diese Zeit. Der Autor setzt ihrer vier in ein
Abendboot mitten auf einen See, den man als Bielersee erkennt. Zwei weitere,
die Sozialbeamtin Ellen und Roman, freischaffender Denker und Schreiber,
«Hofberichterstatter», wie er selber sagt, treffen sich nach der Arbeit
regelmässig im «Hofgarten», einer Berliner Gaststätte. Jede der Personen
redet von ihren Kümmernissen, Anwandlungen, Eindrücken, von ihrer
Befindlichkeit, ihrer Zeit also, und alle reden sie so kurzweilig und
gescheit, dass man beim Lesen die Zeit vergisst. Sie sprechen mit
Geschichten und Geschichtenanfängen oder mit Geschichten, deren Anfänge sie
vergessen haben, sie reihen Erinnerungen, Beobachtungen aneinander,
absichtslos, wie es scheint. Ihre Sprache schafft erst ihre Erfahrungen.
Dann und wann entwickeln sie auch eine kleine Erzähltheorie. Manchmal
schweigen sie, sind schlechter Laune. Nichts ist den Zeitsuchern verboten.
Solange sie offen bleiben für die Gestimmtheit des Augenblicks, solange sie
nicht in Höflichkeitsmasken erstarren voreinander, mit Floskeln die wahren
Verhältnisse vertuschen.
Fliessende Zeit
Allesamt sind sie nicht mehr jung, die Helden, Mitte Vierzig vielleicht,
und sie gewahren die Zeit am eigenen Körper, an erschlaffenden Armen und
Bäuchen. «Reale Körper sind meist nicht schön, sie waren es bloss», bemerkt
Ellen, und sie kann sich nicht genugtun mit der Beschreibung ruinöser
Körperlandschaften: «Die Haut ist in Wirklichkeit immer uneben. Kalte
Stellen wechseln mit heissfeuchten ab. Haare wachsen heraus, wo sie nicht
sollten. Rauhe, karstige Flecken gehen über in weiche, moosige Ebenen.
Knochen ragen hervor. Kühle Fetthügel verlieren sich in runzlighaarigem
Gestrüpp.»
Man hat nicht nur einen Körper, sondern auch einen Beruf. Der aber ist
nicht weiter von Belang. Berufe lenken ab von der Existenz. «Das Sein ist
als Last offenbar geworden», könnten die vier im Boot mit Heideggers «Sein
und Zeit» sagen, sie, die zusammen Kinder waren, die
Komparatistikprofessorin Tana, der Staranwalt Samuel, der weltweit tätige
Ökologe Portman und Linus, der einst eine Lina war, erst Sängerin werden
wollte und dann Sänger und der jetzt zweimal in der Woche im Städtischen
Museum Wache steht.
Fahle Ungestimmtheit
Diese Zuhausegebliebenen oder Zurückgekehrten machen sich nichts vor,
nicht einmal Sympathie. Darum schminken sie ihre Reden nicht um. Linus'
Geschlechtsumwandlung beispielsweise ist kein Thema; das Aussergewöhnliche
ist nichts Besonderes. Ihr hauptsächlicher Seelenzustand ist jene «fahle
Ungestimmtheit», die - nochmals gemäss Heidegger - mit Verstimmung nicht
verwechselt werden darf und die nicht nichts ist, sondern das «Da» jäh und
nackt ins Bewusstsein bringt. Jede Erzählstrategie, eine mit
Spannungserzeugung, mit Anfang, Höhepunkt, Ende, würde ein falsches
Weltverständnis vorspiegeln und das Gleichmass der vergehenden Zeit
überspielen.
Matthias Zschokke greift auf den Novellenzyklus, den Novellenkranz als
ein altes literarisches Muster zurück, um es gleichzeitig zu unterlaufen, zu
minimisieren gewissermassen. Die Jacht, die der begüterten Tana gehört und
die von ihr und den drei Freunden regelmässig aufgesucht wird, gibt den
Rahmen ab für die Selbstergründungen und die fragmentarischen
Binnengeschichten. Auf diesem Schiff erzählt jeder - so spontan wie möglich
- ums Leben, um die Zeit wie Scheherezade in «Tausendundeiner Nacht» oder
die Damen und Herren in Boccaccios «Decamerone». Was bei Boccaccio die Pest,
ist bei Zschokke die Krankheit der Gesellschaft, sich mit allen Mitteln der
Selbsttäuschung kollektiv über Schwermut und Einsamkeit hinwegzutrösten und
sich so um die wahre Gegenwart zu bringen.
Es geschieht naturgemäss wenig, ausser etwa der unverhofften Verknüpfung
der beiden Schauplätze: Ellen, die Berlinerin, ist wieder mal abgehauen aus
dem Höllenradau ihrer Stadt, sie geht weg, um sich nach ihr zurücksehnen zu
können, und logiert im Hotel «Seegurke» just an dem See, auf dem die andern
vier jeweils zusammenkommen. Schwimmend taucht sie nachts am Bootsrand auf,
wird, wie zu erwarten, als Störung empfunden. Sie berichtet dann aber so
kraus, so recht widersinnig vom Abendessen im Hotel, dass sie alle für sich
einnimmt. «Der Kellner sah aus wie ein Mann ohne Oberleib. Der einzige Gast
an einem entfernten Tisch wirkte geköpft. Ich ass ein Schnitzel. Ich weiss
nicht, warum es Schnitzel heisst, fiel mir auf, während ich die Speisekarte
durchlas, also bestellte ich eins. Ein Schnitzelchen mit Salat, sagte der
Kellner, während er es vor mich hinstellte, und genau so hat es denn auch
geschmeckt.»
«Sie können bleiben», sagt Tana darauf, warnt aber doch noch: «. . .
erwarten Sie nichts von uns. Vor allem versuchen Sie nicht uns auf
irgendeine Weise zu gefallen . . . Wir sitzen auf diesem Schiff aus einem
einzigen Grund: Wir wollen in Ruhe gelassen werden . . . Manchmal, wenn's
einem zuviel wird, versucht er sich an einem Zipfelchen von Erlebtem zu
erwärmen und erzählt etwas. Doch wehe ihm, wenn er abgekartetes Zeug
vorträgt! Ich halte das nicht aus . . . Ich ertrage nur Losgelassenes,
Befreites, Pures, Fürsichselbststehendes. All die gezüchtigten,
domestizierten Existenzen, die es sich zur Aufgabe machen, den andern die
Zeit zu vertreiben, diese dressierten Wesen, die im Kreis gehen,
übereinander hüpfen, Purzelbäume schlagen und Heiterkeit vorgeben, um mich
damit von mir selbst abzulenken, sind mir verhasst . . . Erzählen Sie nicht
uns, erzählen Sie sich selbst . . .»
Auf jeder Seite wird vom Erzählen selber gehandelt. Jeglicher
Herrschaftsanspruch und jegliche Konvention, alles Fertige und Verfertigte
soll getilgt werden. So hat Zschokke mit diesem Buch gleich auch seine
Poetik geschrieben. Wie er überhaupt dringlicher als sonst über die
Möglichkeiten der Literatur nachdenkt, auch über ältere Literatur, über die
rätselvollen Einzelverse des späten Hölderlin etwa, über Kleist, Melville
oder auch C. F. Meyers Novelle «Der Schuss von der Kanzel», deren
Hauptmotiv, die losgehende Pistole in der Hosentasche, das einzige jähe
Handlungsmoment im «Losen Glück» abgibt. Das Opfer verblutet, wird beerdigt,
dann ist wieder alles wie sonst. Das Kapitel «Eine Detonation» hat nur kurz
den Fluss der Zeit unterbrochen. Angesichts des dunklen Ozeans, der alles
umgibt, bleibt das Unglück ein Zufall. Andere Grossthemen wie Politik,
Berlin und die Weltgeschichte, Biel und die Wirtschaftskrise drängen
gelegentlich heran, sehen sich gleich wieder verbannt.
Dass aber trotz der Poetik des gelassenen Gleichmasses, der «fahlen
Ungestimmtheit» dann doch eine Fülle unterhaltsamer Geschichten
hineingeschmuggelt werden, gehört zur Selbstironie in diesem Werk. Es ist
vornehmlich der Schriftsteller Roman, der «Hofberichterstatter», der vor
Ellen das Rad schlägt und ihr wundersame Erfindungen auftischt: die
Geschichte von der jungen Frau, die sich plötzlich in den Tod verwandelt und
als allgegenwärtige Gefahr herumgeistert, oder die Geschichte vom
hochstaplerischen Baron und dem Tigerbalsam, der skurrile Bericht über die
Nacht mit dem Transvestiten . . .
Der solches zum besten gibt, ist derselbe, der sein Schreiben sonst als
ein Warten versteht. Nach ein, zwei Stunden Dasitzen im heruntergekommenen
Atelier könne es geschehen, dass «ein Wort vorsichtig den Kopf aus seinem
Loch schiebt, witternd, mit zitternden Barthärchen. Irgendeins, Erdbeere
vielleicht, Blut, Holzfällerchen. Dazu kichert es, ohne mir den Grund für
seine Heiterkeit zu nennen . . .» In Zschokkes letztem Roman, «Der dicke
Dichter», hatte dieses listige Wörtchen einen Namen und hiess Severinchen.
Es war ein übermütiges Mädchen oder Bübchen - dem man nicht über den Weg
trauen konnte. Bei diesem Autor flackert's zwischen den Zeilen.
Matthias Zschokke nimmt sich viel zärtliche Geduld für seine traurige
Komödie vom Suchen nach der Zeit, und seine redseligen Zaubergestalten haben
ältere Verwandte, die Clov und Hamm heissen, Vladimir und Estragon.
("Neue Zürcher Zeitung", 26.8.1999)

Der in Berlin lebende Berner Autor und Filmemacher Matthias
Zschokke meldet sich zurück. «Das lose Glück» heisst sein
neues Buch, das auf eigensinnige Weise die
vorangegangenen Romane fortschreibt.
Von Beat Mazenauer
Vor acht Jahren zähmten die «Piraten» ihre Lebensgier,
indem sie Lethargie über die romantischen Vorstellungen ihrer
Passion wuchern liessen. Und vor vier Jahren verlor sich «Der
dicke Dichter» still und heimlich im Berliner Grossstadtgewirr,
gescheitert am Widerstand der verlogenen Worte. Allesamt
hatten sie es nicht geschafft, im richtigen Leben anzukommen.
Dieses titanische Unterfangen misslingt den Personen auch in
Zschokkes jüngstem Roman. Tana, Portman, Samuel, Linus,
Ellen und Roman erfüllen sich ein loses Glück, indem sie sich
ganz ihrer Trägheit ergeben.
Das Leben hat sie gezeichnet, ermüdet und einsam werden
lassen, ihre «Schwermut ist riesengross geworden mit den
Jahren, hat allen Saft für sich abgezweigt, während Freude,
Lust, Vergnügen und Heiterkeit klein und runzlig geblieben und
nacheinander abgefallen sind.»
Während Roman in Berlin das Leben in seinem Hinterhof
akribisch festhält (und an diesem Roman schreibt?), entflieht
seine Freundin Ellen aus der Metropole in eine
schweizerische Kleinstadt am See, wo sie aus Tana und ihre
drei Bootsgäste trifft. Regelmässig kommen diese Gäste zu
einer abendlichen Ausfahrt auf dem Wasser zusammen.
Geschichten erzählen
Freunde sind sie nicht, erklärtermassen, und gerade deshalb
einander eine gute Gesellschaft. Sie wollen nichts voneinander
als sich ehrlich beschweigen, den Zeitenlauf beklagen und
banale Geschichten in die Runde werfen, doch ohne
Aufmerksamkeit dafür zu heischen. Das rituelle Gleichmass
ihres Beisammenseins genügt, um für Augenblicke der
bürgerlichen Zelle zu entkommen.
Das ist alles. «Überall vergeht die Zeit und es geschehen
grossartige Dinge. Hier nicht.» Die vier und dazukommend
Ellen lagern lethargisch auf dem dümpelnden Boot,
schweigend und erzählend, kaum miteinander plaudernd. Über
ihren Köpfen kreist ruhig der grosse schwarze Vogel
Schwermut.
Unter düstern Wolken
«Das lose Glück» ist ein eigenartiges Buch. Ereignislos wie
das schale Leben und mitreissend wie die Versuche, sich
gegen diese Ereignislosigkeit zu wehren. Die Fünf auf dem
Boot sind aus der Zeit herausgefallen. Manchmal mit
spiessiger Kleinlichkeit, dann wieder mit luzider Abgeklärtheit
lassen sie ihre gescheiterte Anstrengung, das «Gleichgewicht
des Schreckens in meinem Innern», zu Sprache werden.
Trägheit, Bescheidenheit, Feigheit demaskieren die falschen
Hoffnungen von einst. Es ist nichts mehr davon übriggeblieben
als eine nüchterne Trauer, als Ergebenheit in der Melancholie.
«Wir sind nicht begabt, glücklich zu sein.» Einzig in dieser
Einsicht liegt etwas Trost.
Frei von Illusionen
Diese Lethargie wandelt Matthias Zschokke mit erstaunlichen
Zwischentönen ab. Er tut dies weniger experimentell
ambitioniert als früher. Kunstvoll monologisierend lässt er
seine Figuren Abschied nehmen vom Lebensglück.
Allein ihr hoher rhetorischer Aufwand ist verräterisch und
kaschiert nur unzureichend die gebannte Lebenslust. Der
ekstatische Sog hinab in die illusionsfreie Apathie lässt eine
nur schwer gebändigte Wut erahnen.
Der Autor scheint diese melancholische Stimmung gut zu
kennen. Abgesehen von ein paar Spannungsabfällen hält
seine Prosa erstaunlicherweise über die beinahe 300 Seiten
hinweg dicht. Allerdings birgt die Stärke dieser erzählerischen
Konsequenz zugleich deren Schwäche. Es gilt sich
einzulassen auf die unendliche, gleichtönige Schwermut ihrer
trägen Figuren.
("Solothurner Zeitung", 31.8.1999)

Ein Schriftsteller in Berlin, vier Jugendfreunde auf einer Jacht und eine Frau, die den Kontakt zwischen den Schauplätzen herstellt: Matthias Zschokkes neues Buch «Das lose Glück».
Von Elsbeth Pulver
Das Buch führt keine Gattungsbezeichnung im Untertitel, vermeidet also die Behauptung, es handle sich um einen Roman. Und doch kommt der Autor nicht ganz darum herum, sich mit dem Wort zu beschäftigen: er entwirft einmal eine witzig-hintergründige Romantheorie und gibt dem ihm nah verwandten Berliner Schriftsteller den Namen Roman. Als gehe ihm die stereotype Sehnsucht vieler Kritiker nach einem möglichst figuren- und handlungsreichen Roman dennoch nicht ganz aus dem Kopf. Doch tut er alles, diese Erwartungen nicht zu bedienen.
Schwermütiges Palaver
Als eine beliebige Sammlung von Geschichten und Gedanken sollte «Das lose Glück» dennoch nicht gelesen werden. Dann schon eher als eine Sprechkantate für sechs Stimmen, für zwei Frauen-, vier Männerstimmen. Oder als ein Palaver, ein dauerndes Gerede, bei dem man schliesslich nicht mehr ausmachen kann, welche der Figuren redet. Als eine Sequenz von Monologen, die sich zu einem grossen Monolog verbinden, zu einer Elegie auf alles, was uns im Verlauf des Lebens und der menschlichen Entwicklung abhanden gekommen ist.
Das Älterwerden, die Erfahrung der Vergeblichkeit und Vergänglichkeit, das sind die grossen Themen, mit denen sich vor allem die vier Jugendfreunde - sie heissen Tana, Samuel, Portmann, Linus - in ihren nächtlichen Gesprächen auf dem See beschäftigen. Und weder die komfortable Jacht noch ihr materiell ziemlich sorgenfreies Leben können sie trösten; auch die Freundschaft, welche die Gruppe auf eine zuverlässig-oberflächliche Art verbindet, kann es nicht. Und dem Schriftsteller Roman und der mit ihm befreundeten Ellen, die beide mehr zufällig nach Berlin gekommen und dort geblieben sind, geht es nicht anders.
Schwermut prägt das Buch. «Sie ist riesengross geworden in den Jahren, hat allen Saft für sich abgezweigt», so, rückhaltlos, sagt es Tana, wohlhabende Jachtbesitzerin und unbedeutende Professorin für Komparatistik, die Wortführerin in dieser durch Einfälle und Geschichten nur wenig verhüllten Schwermutslitanei.
Jugend-Charme verloren
Die Figuren des neuen Buches sind, versteht sich, späte Nachkommen jener ausnahmslos jungen Protagonisten, mit denen Zschokke in seinen ersten Büchern erfolgreich debütierte. Nur sind sie - diese frühreif-altklugen «Max» und «Prinz Hans» - zusammen mit dem Autor älter geworden; sie haben den Charme und die unsicheren Hoffnungen ihrer Jugend verloren - und können nicht recht erwachsen und noch weniger älter werden. Das ist das Problem, das vor allem die vier gleichaltrigen Jugendfreunde auf dem Bielersee beschäftigt.
Immer wieder wird im Reden und Erzählen die Frage nach dem Sinn und einem möglichen Glück in diesem Leben laut, danach, was eigentlich wünschenswert, erwähnenswert, lebenswert wäre. Die Erinnerung an früher gibt den Ratlosen keinen Halt. Denn die Bücher Zschokkes sind an die Gegenwart gebunden, an diesen einen, unwiederholbaren, deshalb so wertvollen, deshalb so fragilen Augenblick. Aber noch weniger Gewicht wird der Zukunft beigemessen, schon gar nicht jener Version von Zukunft, die dem Schriftsteller Roman quasi vor seine Berliner Türschwelle gelegt wird. Die neue Ära, die neue Rolle der Stadt als Zentrum Deutschlands, das «Jahrtausendgezeter und das Gewinsel über historische Entwicklungen», das alles hat für diesen Autor, der in der Provinz aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in der Metropole lebt, kein Gewicht. Was ihn interessiert, immer und überall, ist das Kleine und Unscheinbare, ja Schäbige, das, was sich in Hinterhöfen und Nebenstrassen findet.
Fasziniert vom Wertlosen
Mit Bewunderung, ja mit Neid beobachtet Roman einmal, gegen Schluss des Buches, ein Kind, das selbstvergessen alles untersucht, was sich am Strassenrand findet, alles Weggeworfene und Wertlose. Zwar weiss Roman, und mit ihm weiss es der Autor, dass er das Kind nicht nachahmen kann; dessen vorurteilsfreie Aufmerksamkeit ist für den Erwachsenen ein verlorenes Paradies, ist Inbegriff dessen, was im Titel das «lose» (das fragile, weil unbeständige) Glück genannt wird. Und dennoch hat das Schreiben, das Zschokke hier praktiziert, etwas mit der Beobachtung des Kindes zu tun.
Und dies ist es, was einen im Lesen immer wieder für diesen Autor einnimmt: Dass er unbeirrt durch die gerade geltenden Erwartungen und Vorstellungen seinen Weg geht und ein Aufheben macht von Dingen, denen andere keinen Blick gönnen.

All die ausufernden Monologe verdüsterter Geistesmenschen, die, von Beckett bis Bernhard, die Literatur zu bieten hat, beruhen auf der empirisch unwahrscheinlichen Annahme, dass auf der anderen Seite jemand ist, der zuhört. Kaum je hat man der fiktionsnotwendigen Figur des literarischen Zuhörers die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Im Leben wird man diese Spezies dagegen selten antreffen. Wer hat schon üblicherweise Zeit und Lust, dem Gegenüber über Seiten und Stunden bei der Äußerung von Mitteilungen mit oft minderem Neuigkeitswert still zu assistieren, wer möchte nicht zwischendurch auch mal etwas bemerken dürfen? Die Figuren in Matthias Zschokkes neuem Prosabuch "Loses Glück" stehen unter Sprech- und Bekenntniszwang, aber manchmal ahnen sie noch, dass am anderen Ende des Kanals der Empfänger schon sanft entschlafen sein könnte. "Hört ihr mir überhaupt zu", fragt zum Beispiel Tana nach zweieinhalbseitiger Rede in die Runde, und das Echo bleibt matt. Der eine zieht tief Luft ein, der zweite nimmt einen Schluck Wein, der dritte behauptet, nicht zu verstehen. Was freilich für Tana kein Grund ist, nicht auf der Stelle zum nächsten, diesmal fünfseitigen Sprechakt anzuheben. Wenn man sich als Leser darauf eingestellt hat, dass in diesem Buch außer Reden nichts, aber auch rein gar nichts geschieht - abgesehen davon, dass einmal versehentlich eine Pistole losgeht -, wenn man sich einfach vom Schwall dieser maßlosen und artistischen Reden mitreißen lässt, dann kann auch die stille Teilhabe einen Kunstgenuss bedeuten. Beinahe staunend sieht dem Akrobaten Zschokke bei seinem Kunststück zu: die Statik nämlich seines Buches (das nicht "Roman" heißt) kommt ohne die üblicherweise tragenden Elemente aus und trägt trotzdem.
Die Handlung nimmt knapp eine halbe Seite ein. "Sie sind zu viert und sitzen auf ihrer Yacht", heißt der erste Satz, und kurz vor Schluss gibt es dann eine Art Zusammenfassung. Sie besagt, dass vier Freunde einen Abend auf einem See verbrachten. Eine Schwimmerin störte ihre Ruhe. Die Freunde zogen sie aus dem Wasser und ließen sie an Bord sich ausruhen. Im Verlauf des Abends zeigte die Besitzerin der Yacht eine Pistole. Sie trug sich mit Selbstmordgedanken. Ein anderer nahm die Pistole in Verwahrung. "Irgendwann später löste sich in seiner Hosentasche aus Versehen ein Schuss und tötete ihn. Dann gab es eine Beerdigung." Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Was die Personen der Nicht-Handlung reihum abliefern, sind zierliche Klagegesänge. Melancholie und Langeweile bilden den Cantus firmus einer mehrstimmigen Musik, die so schwermütig gar nicht klingt. Die Figuren leiden beschwingt: an einem Dasein, das zwar komfortabel ist, nun aber zum größeren Teil hinter ihnen liegt, sie leiden an einem Leben, das wie ihr eigenes aussah, nun aber doch ins Meer der Üblichkeiten gemündet ist. "Es entsteht kein ruhig gelebtes Leben mehr", bemerkt Protman. Die vier sind des Hergebrachten müde und des Neuen überdrüssig, schon ehe es begonnen hat. Statt sich auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten zu blamieren, sitzen sie lieber weintrinkend auf Tanas Yacht. "Schaut die Wülste an mir", deklamiert Tana, "schaut die Tränensäcke, schaut die langgewordenen Zähne, die schwarzen Lücken dazwischen, die matten Haare. Was habe ich verbrochen? Was haben wir auf uns geladen, dass wir so Ekel erregend werden, so abstoßend?!" Tana übertreibt. Alle übertreiben in diesem Buch. Sie übertreiben, sobald sie reden, so wie Opernsänger auf der Bühne die Gesten übertreiben. Tana ist Professorin für Komparatistik und hat von ihren Eltern eine Villa im Park geerbt. Samuel ist Wirtschaftsanwalt und arbeitet Tag und Nacht. Portman ist weltweit in Sachen Ökologie unterwegs. Linus hieß einmal Lina. Seine Sängerkarriere ist gescheitert, aber eine Erbschaft hat ihn unabhängig gemacht. Sorglos, aber betrübt sitzen die vier "ums schwarze Loch der Verzweiflung" herum wie um ein Lagerfeuer. Sie behaupten, sich zum Schweigen zu treffen. "Alle vier haben sie nichts erlebt und nichts vor, das zu erzählen sie reizen würde." Und so wäre es wohl auch diesmal, wenn nicht Ellen aus Berlin ihre Ruhe störte, die Schwimmerin. Sogleich wird sie von Tana über die herrschenden Rede- und Schweige-Etikette in Kenntnis gesetzt: Sie ertrage nur "Losgelassenes, Befreites, Pures, Fürsichselbststehendes". Und: "Kümmern Sie sich nicht, ob wir Ihnen zuhören."
Ein fremder Ankömmling auf einem Boot, das ist ein Motiv, aus dem sonst Thriller oder Psychodramen gemacht sind. Nicht so bei Zschokke. In seiner Sprechoper finden alle Abenteuer in direkter Rede statt. Das Abenteuer sind Ellens Reden selbst. Sie redet wie manche Figuren in frühen Botho-Strauß-Stücken: fahrig, durchgedreht, visionär. Sagt Sachen wie: "Eine Malerin fällt mir dazu ein. Die war freudlos, um nicht zu sagen verzweifelt. Niemand wollte eines ihrer schwefelgelben Bilder kaufen. Die Haare fielen ihr aus vor lauter Gram. Wer erfolglos schwefelgelbe Bilder malt, schämt sich nach einer Weile entsetzlich für sein Tun." Tana ist begeistert: "Ich kann gut denken, während Sie sprechen. (...) Das Material, das Sie anhäufen, bröckelt. Es ist puderig und hält nicht zusammen." Nun fangen auch die anderen an, aus ihrem Leben zu berichten, von erotischen Katastrophen oder von Kindern, "die aus uns herausgekrochen sind und nun ebenso leer und ziellos äsend in der Landschaft stehen wie wir". Samuel lobt Ellen; man könne fabelhaft abschweifen, "weil das, was sie sagen, so offen ist, so ohne Zentrum, ohne Welt". Keine unpassende Beschreibung, die Samuel hier für Zschokkes Schreibweise gibt. Man weiß nicht, wo es spielt, weiß nicht, womit es spielt, sieht keinen Anfang und kein Ende, und ist doch von diesem manieristischen Sprach-Spiel zuerst verwundert und dann bezaubert. Örtlich kann es auch vorkommen, dass dem Leser, auch wenn - oder weil - fast jeder Satz schön anzuschauen ist, der Mitteilungsdrang der Figuren zu viel wird.
Aber dann kommen wieder Sätze wie dieser: "Den Vorgang des Sichaustauschens halte ich für einen wichtigen." Satz für Satz demonstriert Zschokke, welch komischer Vorgang das wahrhaft "befreite", "pure" Sichaustauschen sein kann. Und wie selten er vereinbar ist mit dem "losen Glück", das Zschokkes Buch im Titel führt und seinen Figuren nur für den Fall in Aussicht stellt, dass sie werden wie "zerrupfte Hühner (...), ausgelastet mit den Schwierigkeiten, über einen Hof zu schreiten, vogelfrei". Wollte uns Matthias Zschokke so etwas ähnliches zu bedeuten geben? Egal, "Sie mögen mir erzählen, was Sie wollen, es ist mir alles gleich seltsam und unbegreiflich, wie Zauberei."
("Frankfurter Allgemeine Zeitung", 12.10.1999)

Alles beginnt auf einem See im schweizerischen Mittelland, an einem warmen Sommerabend. Und dauert bis in die Nacht hinein. So lange nämlich sitzen vier Personen aus der am See gelegenen Kleinstadt auf einer bequemen (wenn nicht luxuriösen) Jacht und trinken Wein. Sie bekommen in den paar Stunden ihres Zusammenseins alle (vom Autor) ihre Lebensgeschichte oder erzählen sie einander, mitsamt den vielen sonstigen Geschichten, von denen das eigene Leben durchzogen zu sein pflegt. Die Voraussetzungen für so etwas wie Glück sind also gegeben: ein Glück wenigstens für die Dauer eines Sommerabends auf dem See, das nicht mehr ganz wetterfeste, beständige Glück, «das lose» eben, wie der Titel des Buchs es verheisst.
Doch «das lose Glück» ist darin für die Hühner vorgesehen: «Zerrupfte Hühner, die nicht wissen, dass sie sterben, die ganz und gar damit beschäftigt sind, Hühner zu sein, sich in den Sand zu hocken, wieder aufzustehen, das Gleichgewicht zu halten, ausgelastet mit den Schwierigkeiten, pickend über den Hof zu schreiten, vogelfrei im losen Glück.»
Das Erzählen und der Sarkasmus
Die Menschen bei Zschokke, das ist der ganze Unterschied zu den Hühnern, wissen, dass sie, täglich und stündlich, sterben. Und am besten meinen es die vier auf dem See zu wissen. Sie trauern der Zeit nach, «als noch nicht alles ein einziger Abstieg war», und erkennen staunend und schaudernd, wie schnell sie vergangen ist und weiter vergeht, während sie reden und klagen darüber, irgendwann anfangen damit und dann weiterreden und -klagen, in endlosen Monologen, die zeitweise nicht einmal mehr einer bestimmten Person zugeordnet sind. Weil das Reden aller nur der vergebliche Versuch ist, (sich) die Zeit zu vertreiben oder, noch besser (und noch wörtlicher!), sie totzuschlagen; denn im Schweigen könnte ihr Vergehen noch ungedämpfter hörbar werden.
Die endlosen Monologe sind die schöne Zumutung von Zschokkes Prosa. Nicht erst im Roman «Das lose Glück». Aber so knapp wie hier hat dieser Autor noch nie den Punkt verfehlt, wo sein Erzählen suggeriert, nichts anderes als dieses Kontinuum des Monologisierens im Sinn zu haben. Oder jedenfalls überhaupt nicht davor zurückzuschrecken. (Dieselbe Neigung kennzeichnet auch Zschokkes neuste Theaterstücke. Aber sie werden gespielt. Zur Zeit gerade «L'ami riche», noch vom verstorbenen Gilbert Musy übersetzt, in einer erfolgreichen Lausanner Produktion.) Im literarischen Trend (was immer der gerade sei, mit Zschokkes Prosa und Theater will er zweifelsfrei nichts zu schaffen haben!) liegt der Autor damit nicht. Aber das stört ihn nicht nur nicht, das muss vielmehr so sein, wie aus den völlig unangestrengt in den monologischen Erzählfluss integrierten Passagen über die Literatur oder über Literaturtheorien hervorgeht.
Eine von ihnen beschäftigt sich sarkastisch mit dem Einschläfernden eines Erzählens, das um seines Unterhaltungswerts willen auf Anfang, Mitte und Ende bestehen zu müssen glaubt. Zschokke hegt und pflegt den Sarkasmus solcher Passagen auch, um nicht selber der Versuchung zu abgerundeten Geschichten zu erliegen. Diejenigen seines Romans (in dem es eine Fülle von unvergesslichen Liebes- und Reisegeschichten gibt) sind meist ohne erkennbaren Anlass begonnen, sie interessieren nur die wirklich, die sie erzählen, und auch denen ist irgendwann das Ende entfallen, sofern es ihnen nicht der Tod abgenommen hat.
Der Weltschmerz und die Komik
Doch auch ohne dessen Eingreifen wissen diese Binnengeschichten (wie die Lebensgeschichten) wenig oder nichts vom Glück. Und umso mehr von der Resignation. Sie sei «keine schöne Gegend», hat Gottfried Keller auf ein Löschblatt notiert. Für die ZschokkePersonen ist sie es auch nicht und kommt nie aus der Gelassenheit, die sich abzufinden weiss mit dem Naturgesetz der Vergänglichkeit, der eigenen und der der Welt.
Es ist nicht verboten, bei Zschokke vor allem den althergebrachten Weltschmerz am Werk zu vermuten. Dem Autor und seinem literarischen Personal dürfte an einer besseren Herkunft des nostalgischen, elegischen Redeflusses wenig gelegen sein. Aber sie sind sich (in einer selbstironischen Solidarität) auch völlig im Klaren darüber, dass der Weltschmerz heute nicht mehr ausreicht für die Tragödie. Sondern bestenfalls und gelegentlich für die Tragikomödie. Und in ihr (wie ein paar Buchseiten über Kleists «Amphitryon» bestechend nachweisen) steht das Komische seit jeher auf wackligen Füssen.
Der Tod und das Tränenlachen
Bei Zschokke auch da, wo es sich weit in die Sätze hervorwagt. Wenn diese, z.B., von einer Demonstration erzählen, deren Teilnehmer (einschliesslich der beiden Polizisten an der Spitze des kläglichen Zugs) auf einer leicht abschüssigen, plötzlich vereisten Strasse nur noch ein (und sicher nicht ihr ursprüngliches) Anliegen haben: gemeinsam mit der Tücke der Verhältnisse fertig zu werden. Die Tragikomödie minus das Komische ergibt so noch lange nicht das Tragische. Sie ruft nur in Erinnerung, dass das Leben manchmal buchstäblich zum Tränenlachen sein kann. Sogar auf Kosten eines toten Kindes. Die beiden Angestellten einer Bestattungsfirma tragen es auf einer Bahre zum Kleintransporter vor einem Berliner Mietshaus. Sie stellen sich dabei so ungeschickt an, dass der Vorgang zur Slapstick-Szene ausartet, die im Satz gipfelt: «Die kleine Leiche federt, als gings im Frühtau zu Berge.» Ein genial pietätloser Satz. Aber noch in der Pietätlosigkeit ist er (wie die ganze, in den Bewegungsabläufen akribisch genau beobachtete Szene) nichts als die Wahrheit und als solche eine nachhaltige Attacke auf das verlogene, kurzlebige Mitgefühl, mit dem ein totes Kind in der Literatur wie im Leben nicht nur rechnen kann, sondern muss.
Der Róman und der Román
Aber die Rezension will zurück, in die weite, zwar auch längst winterliche Seelen-Landschaft der vier auf der Jacht. Sie haben unterdessen Gesellschaft bekommen. Ellen, Sozialarbeiterin aus Berlin, ist aus der Schwärze der Nacht aufgetaucht und an Bord genommen worden. Die Wege, auf denen sie ausgerechnet hierher gelangte, sind erzählerisch verschlungene. Aber der Autor Zschokke ist auch auf ihnen ein begeisternder Guide. Was er Ellen auf der Jacht von ihrem Leben in Berlin und von der Reise an die Ufer des Sees erzählen lässt, setzt sich nicht durch und verändert die vier, die ihr zuhören, nicht. Dafür ist Ellen zu scheu und eine zu höfliche Zuhörerin. Aber vereinnahmen lässt sie sich von der melancholischen Suada der Gastgeber nicht. Und am Ende des Buches (nach dem lautesten Schuss, der je seit dem von der Kanzel gefallen ist!) reist sie, trotz der Bitte zu bleiben, weiter. Nicht zurück. Sondern weiter auf der Suche nach Freunden, die anders sind als der einzige, den sie in Berlin hatte, und von dessen zunehmender Depressivität sie sich beurlauben wollte und dabei vom Regen in die Traufe geraten ist.
Der Bentley und der Eisenbieger
Dieser Freund, namens Roman (von Zeit zu Zeit sollte der Name auch auf der zweiten Silbe betont werden!), ist Dichter. Von seiner psychischen Verfassung her und in seiner Oblomow-Müdigkeit würde er bestens zu denen auf der Jacht passen. Aber die Glanzlosigkeit und Dürftigkeit seiner Berliner Existenz sind per se ein Gegenprogramm zum luxuriösen Glanz der Lethargie auf dem See.
Dazu kommt, dass der Román den Róman zur «Hofberichterstattung» anstiftet und «Auf Patrouille» schickt. Roman nimmt, in den jeweils so angekündigten Passagen, in Augenschein, was auf dem Hof unten und auf seinen Gängen durch die Stadt tagtäglich sich ereignet und verändert.
Ach nein, zum grossen Berlin-Roman und -Fresko setzen die kleinen und unauffälligen Geschichten und Bilder, die dabei herausschauen, sich nicht zusammen. «So ganz ohne Zentrum. So ganz ohne Welt» wie sie sind, muss ein solches Pensum ihnen nur lächerlich vorkommen. Und Literatur darf bekanntlich sogar den grossen historischen Augenblick verpassen. Oder ihn nur in maliziösen Andeutungen zur Sprache bringen. Um sich dann dem zuzuwenden, was die Historie in ihrem Präpotenzgehabe immer missachtet. Das kann die Lebensmüdigkeit von vier Menschen auf einem unwirklich schönen See sein. Oder der arbeitsame Eisenbieger Mewes, der im Hof drunten seinen Bentley wäscht. Wenn das Auto denn wirklich ein Bentley ist und Herr Mewes wirklich ein Eisenbieger.
("Basler Zeitung", 9.11.1999)

Tana, die Besitzerin der Jacht, sagt zu
ihren drei Freunden und zeigt dabei eine
Pistole, sie werde jetzt ins Wasser
steigen, sich in den Kopf schiessen und
versinken. Regt sich ob dieser makabren
Ankündigung einer der drei - Samuel,
Linus, Portmann - auf? Nicht die Spur.
Sie verharren in träger Melancholie, in
einer Art schmerzfreier und halbwegs
glücklicher Ermattung. Immerhin nimmt
Portmann Tana die Waffe weg und
versorgt sie in seiner Tasche. Das
allerdings hätte er gescheiter
unterlassen, denn Stunden später und
rund zweihundertsiebzig Seiten weiter
hinten im Buch wird er sich
versehentlich ins Bein schiessen,
verbluten und sterben. Doch nach
einem Moment hysterischer Aktivität
der Leute auf der Jacht ändert auch
das nicht viel an der lethargischen
Stimmung. Der Nebel der
Ereignislosigkeit schliesst sich wieder
über den Zurückgebliebenen.
Zu diesen ist übrigens vorher noch
eine wildfremde Schwimmerin
gestossen, eine Frau aus Berlin, wie
sich zeigt, die ferienhalber in die
Gegend und an den See geraten ist, auf
dem die Jacht dümpelt und der der
Bieler- oder der Neuenburgersee sein
könnte, jedenfalls ein schweizerisches
Binnengewässer aus jener Region, in der
Matthias Zschokke, der jetzt in Berlin
lebende, 45-jährige Schauspieler,
Schriftsteller, Dramatiker und
Filmemacher, seine Jugendzeit
verbracht hat.
Und mit Ellen, der Schwimmerin, die mit
widerwilliger Gastlichkeit auf die Jacht
und in den Kreis der dort Weilenden
aufgenommen worden ist, kommt noch
deren Berliner Gefährte, Roman,
irgendwie mit ins Spiel; also haben wir
es jetzt insgesamt mit sechs Leuten zu
tun. Diese Leute, was treiben sie
überhaupt, was treibt sie an und um?
Tja, das sind im Grunde schon fast allzu
dramatische Fragen in Bezug auf die
paar Personen, die offensichtlich ihre
Jugendlichkeit und damit auch ihre
Jugendträume längstens schon
abgestreift und sich danach
eingerichtet haben in dem, was im Buch
einmal «das würgende Elend des
Gemütlichen» oder auch «die
Monstrosität des Gemässigtseins»
genannt wird.
Zschokke ist schon anlässlich seiner
ersten Veröffentlichungen immer etwa
mit seinem Landsmann Robert Walser
verglichen worden. So wie sich in
seinem neuen Buch Komik und
Melancholie die Hand reichen,
Poetisches mit Spöttischem, Träumerei
mit Witz sich verschwistert, fühlt man
sich in der Tat dann und wann wieder in
Walsers kleinen Kosmos versetzt; da
wie dort hat man es (ein Ausdruck
Zschokkes) mit der «Tapferkeit des
Allerweltlebens» zu tun. Wie endet
Zschokkes Buch? So: Roman sagt zur
Verkäuferin in der Berliner Konditorei,
die er zu frequentieren pflegt: «Ich
freue mich unbändig auf übermorgen,
auf Sie im neuen Jahr, auf Ihre Kuchen,
vielleicht gelingt es uns» - und Schluss
ist ohne Punkt. Das Leben oder vielmehr
die Attitüde des Lebendigseins könnte
weitergehen wie bisher.
Der Ausdruck «unbändig» ist an dieser
Stelle ohnehin eine ungeheure, eine
sozusagen walsersche Übertreibung.
Gerade Unbändiges kommt nicht vor in
Zschokkes Buch, vielmehr ists die
sanfte Melodie des alltäglichen
Mittelmasses, das halbe Glück der
Resignation, das mild Elegische
herbstlicher Existenzen, die es
ausfüllen. Die sechs Leute übrigens
reden nicht eigentlich miteinander,
sondern sie monologisieren mehr oder
weniger träge vor sich hin, jede und
jeder ist vor allem mit sich selbst
beschäftigt. Aber auf diese Weise
lernen wir Leser nach und nach ihre
Herkünfte, ihre Entwicklungen
(Schicksale wäre schon ein zu
dramatisches Wort), ihre
unterschiedlichen Charaktere kennen,
und mit ihnen und durch sie werden wir
in mancherlei Szenerien und
Lebensstimmungen gezogen. Diese
spielen sich ab und dehnen sich aus
hier herum und in Berlin, auf Feldwegen
wie auf städtischem Asphalt, in
trübseligen Gaststätten und in hell
erleuchteten Theaterpalästen, in
staubiger Banalität, aber auch, selten
einmal,in der klaren Luft grosser
Dichtung, die erinnert und zitiert wird.
Und das ergäbe den Stoff für ein Buch von nahezu dreihundert Seiten? Ja, gewiss. Zschokke komponiert und garniert nämlich die scheinbare Gleichförmigkeit und Ereignisarmut so abwechslungsreich, so kunstvoll, so gesättigt mit eigenwilligen und einprägsamen Bildern, und er entwickelt mit Sprachlust und -witz viele Geschichten oder Anfänge von Geschichten aus der einen grossen Geschichte (wobei er die meisten Erwartungen der Leser raffiniert unterläuft), dass man - obgleich es sich ja insgesamt um Figuren in den allermässigsten Lebenszonen handelt - von einer skurrilen Überraschung zur andern, von Entdeckung zu Entdeckung gelockt wird. Am Ende, das ja kein Ende sein will, hätte man es ganz gerne, dass eine oder einer der Beteiligten an diesem ebenso bunten wie zartfarbenen Gewebe weiterwirken würde.

«Wir alle haben nichts erlebt, und wir alle können nichts erzählen. Das ist eine
Seuche, die uns befallen hat. Alles, was wir tun und denken, zerfällt immerzu. Es
formt sich nichts Erlebtes daraus, bei niemandem. Wir haben einen Virus in uns,
der alles zersetzt und auflöst. Es entsteht kein ruhig gelebtes Leben mehr.»
Das sagt Portman, einer von vier Freunden, die auf einer Jacht die Nacht
verbringen erzählend, dösend, im Gespräch. Sie sind nicht wirklich Freunde,
mehr Gefährten, die aneinander gewöhnt sind, die sich diese Zuflucht ausserhalb
des Jetzt und Hier, eine Art Schonraum des Belanglosen und Unverbindlichen
erwählt haben.
Portman, Tana, die reiche Bootsbesitzerin, die sich lieber auf dem Wasser
aufhält als in ihrem Herrschaftssitz, Linus, der als Lina begonnen hat, und
Samuel: gewöhnliche Menschen. Samuel «hat fünf Kinder und eine zarte,
krankheitsanfällig Frau», ist Anwalt und führt eine eigene Kanzlei. Portman
beurteilt Landschaften, kennt sich aus im ökologischen Gleichgewicht, doch nicht
in der Ökologie der Beziehungen; er hat eine Geliebte. Die vier wuchsen im Ort
auf, trafen sich mit andern Schülern damals im Café Central, sind hier und
aneinander hängen geblieben, treffen sich, ohne dass sie viel verbindet. «Sie
kennen einander zu gut und sind sich dabei entglitten.»
Herausgehoben
Bis zu jener Nacht, in der eine Schwimmerin auftaucht, an Bord genommen
wird. Aus ihrer Gegenwart entstehen Verbindlichkeiten, die vier haben eine
Zuhörerin, eine Fremde erweitert den Kreis der Vertrauten, ihr Zuhören
verändert das Erzählen. Nichts anderes wird erzählt, aber es hallt anders nach,
und jetzt erzählt auch jemand anderer. Ellen, die Schwimmerin, die die Koffer
gepackt und sich aufgemacht hatte, Freunde zu suchen, erzählt nicht von
Ereignissen, nicht von «Jetztzeitigkeit, Aktualität», sie ist auf ihre Weise genauso
weltentrückt, herausgehoben aus dem Alltag wie die vier auf ihrer Jacht.
Ellens Geschichte spielt an einem andern Ort, in Berlin, wo sie sich regelmässig
mit Roman trifft, um mit ihm im Restaurant Hofgarten zu essen. Aus Zufall
haben sie sich kennen gelernt, auch sie sind sich nicht wirklich nahe gekommen,
haben sich nur an die Regelmässigkeit von Begegnungen gewöhnt, erleben eine
Geschichte miteinander, die keine ist und sich doch zum Aufschreiben eignet:
Roman macht am Ende des Buches Kopien, steckt sie in einen Umschlag,
schickt sie weg.
Immer neue Geschichten
Es steht zu vermuten, dass aus den Kopien dieses Buch wurde, Matthias
Zschokkes neuer Roman «Das lose Glück». Es ist ein fragiles, schwebendes
Kunststück über lauter Ereignislosigkeit, über eine Zeit und Gesellschaft, in der
«die Vorstellungen spriessen, die Möglichkeiten welken», in der es nicht mehr
gelingt, vom Glück zu reden: «In einfachen Kulturen wie der unseren gibt es
keine Ausdrucksform für das Glück. Da wirkt alles schal, was nicht leidet und
sich quält.» Und keiner weiss hier zu sagen, «ob es tatsächlich sinnvoll ist, immer
neu und immer schöner zu sagen, was wir alle längst wissen».
«Was wir alle längst wissen» schlägt sich nieder in immer neuen Geschichten, in
Ereignisketten, Beziehungsgeflechten, die Roman in seiner
«Hofberichterstattung» festhält, wie er mit ironischem Unterton seine
Beobachtungen in den Berliner Höfen und Hinterhöfen überschreibt. Es gerinnt
in den beiläufigen Berichten der vier Freunde auf ihrer Jacht, die über all das
Bedeutungslose monologisieren, das ihnen widerfahren ist, das sie als Akteure in
einem spielerischen Leben das Schicksal zu nennen bei weitem zu pathetisch
wäre zu Wege bringen.
Am Ende holt ein Ereignis sie aus ihrem dämmernden, traumverlorenen Zustand:
Portman hat sich mit einer Pistole versehentlich ins Bein geschossen, er verblutet
an der Wunde. Die Waffe hatte er Tana abgenommen, die damit ins Wasser
steigen und sich erschiessen wollte. Sein Tod, der jetzt an die Stelle von Tanas
verhindertem Selbstmord getreten ist, macht alles Erzählen von diesem Ende her
zu einer letzten Gelegenheit, jetzt erhält es Belang und Bedeutung.
Am Ende des Ereignishaften
So verhalten melancholisch Matthias Zschokke in diesem Roman eine Welt am
Ende des Ereignishaften erzählen lässt, so poetisch verbrämt diese Endzeitsicht
sich aus vielerlei Facetten von Lebensläufen und -entwürfen zusammenfügt: Es
ist ein präziser Spiegel der Gegenwart, einer auseinander driftenden Zeit und
Gesellschaft. Und Berlin, dieser Hauptort, der zu einem Nebenschauplatz wird,
gerät zum Katalysator einer Geschichte, die bei aller Negation des
Glücksvermögens und der Liebesfähigkeit von beidem spricht, vom Glück wie
von der Liebe. Nicht immer im direkten Bild, zuallermeist im Gegenbild, im
Widerschein des Scheiterns, in der Sehnsucht nach dem Ungeschehenen. Auf
jenem nächtlichen See taucht ein Engel aus Berlin auf.
Das ist ein zauberhaft leichter Roman, der alle Weltenschwere aufhebt und sich
doch nicht weltverloren ins Idyllische flüchtet. Eine Feier des Erzählens als jenes
schöpferischen Werden, aus dem die Welt erst ihren Sinn erhält. «Das lose
Glück» meint hier beides: das Gelöstsein von allem Glück im Glücklosen, von
dem in diesem Buch erzählt wird und gerade darin scheint ein leichtes, gelöstes
Glücklichsein auf, das jedem zukommt, der erzählen kann.

Es geht um viel Statik in diesem Buch, das kein Roman sein will. Was
zählt, ist die richtige Balance, das Halten und Verlieren des
Gleichgewichts. „Gesellige Schonung“ hatte sich in Goethes Novellenkranz
Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten eine Adelsgesellschaft
erbeten, die vor der Französischen Revolution geflüchtet war. Diese
Einstellung, die „alle Unterhaltung über das Interesse des Tages“
ausschloss, wurde zum Prinzip des abwechselnden Erzählens, mit dem sich
die Herrschaften die Zeit vertrieben. Die Figuren im Losen Glück fliehen
eigentlich nur vor sich selbst, und das ist bekanntlich am schwersten.
Es handelt sich um ein bürgerliches Quartett jenseits der vierzig: Tana,
Alleinerbin und Dozentin für Komparatistik, der erfolgreiche Anwalt
Samuel, der mit Realitätssinn begabte Forstingenieur Portman sowie der
Transsexuelle Linus, der als Lina angefangen und sich selbst und seine
Sängerkarriere irgendwann vergessen hat. Nun will er nichts mehr werden,
„nur noch sein“. Das Statische wird zum Programm: „Überall vergeht die
Zeit, und es geschehen großartige Dinge. Hier nicht.“ Die vier
Jugendfreunde, offenbar verkappte Epikureer, flüchten regelmäßig vor den
Zumutungen und Verbindlichkeiten auf schwankenden Boden: Sie treffen
sich an Bord von Tanas Jacht auf einem See im Schweizer Mittelland, der
sich als Bielersee deuten lässt.
Matthias Zschokke, Schöpfer luftig verschmitzter Helden wie „Prinz Hans“
oder zuletzt „Der dicke Dichter“ (1995), orchestriert einen mehrstimmigen
Schwanengesang auf die dahingehenden und vor allem dahingegangenen
Jahre, eine Elegie des Verfalls. Man möchte von einem typischen, etwas
anämischen Fin-de-siècle-Buch sprechen, in dem sich der Ennui in
wunderschöne Episoden und Metaphern kleidet – aber es bleibt eben
doch der im Grunde immer gleiche, um sich selbst kreisende Ennui, das
taedium vitae, das mit dem Altern seinen sichtbaren Ausdruck findet:
Fettwülste, Tränensäcke, länger werdende Zähne, matte Haare, alles wird
wort- und variationsreich beklagt. Hier ist niemand ins Gelingen verliebt,
sondern jedermann ins Scheitern. Trostlosigkeit kann ja so schön sein,
besonders wenn man es sich im Leben kommod eingerichtet hat wie Tana:
„In englischen Gesellschaftsromanen tauchen manchmal solche Erbinnen
auf, fahren im Jaguar durch grüne Landschaften und erinnern sich an
feuchte Internatstage.“
Die vorgeführte ideale Erzählgesellschaft, deren äußere Koordination wie
im aristotelischen Theater örtlich (die Jacht) und zeitlich (ein Abend) eine
Einheit bilden, erfährt eine Störung und gleichzeitig geistige Befruchtung
von außen, direkt aus dem Wasser: Eine Schwimmerin bittet, von der
langen Strecke ermattet, an Bord kommen zu dürfen: Das Standlicht des
Schiffes habe sie angezogen. Sie stellt sich als Ellen aus Berlin vor,
Sozialarbeiterin im Urlaub, abgestiegen im Hotel „Seegurke“. Im
bewährten Gefüge der vier kommt ihr, dem Eindringling, bald die zentrale
Rolle: als Unterhalterin zu – denn sie erzählt absichtslos, ohne „es
gutmachen zu wollen“, so wie die Gastgeberin Tana es
erwartet, ja anordnet – „lassen Sie es fließen“.
In die Monologe über mehrere Seiten, die mit einem schlichten „sagt:“
nach Art von Drehbüchern eingeleitet werden, sind Binnenerzählungen als
Berichte von hochdifferenzierten Alltagsbeobachtungen und menschlichen
Bemühungen eingebettet. Zschokkes Charaktere sind
Wahrnehmungskünstler. Ihr geschärftes Erkenntnis-Instrumentarium trifft
zwangsläufig auf dumpfe Zustände, denen gegenüber es machtlos ist.
Sensible Gemüter treibt das in die Resignation; „denk der Vergeblichen!“
möchte man mit Gottfried Benn ausrufen.
Doch schließlich wirkt auch die ästhetisch erlesen verpackte
Absichtslosigkeit auf Dauer penetrant. Ob es tiefgefrorene Erbsen sind, die
im Karton rasseln, lästige Fruchtfliegen oder ein Staubfaden in der Sonne
– nichts ist vor ausführlichster Beschreibung sicher. Der Autor macht
programmatisch das Kleine zum Großen, was er durch die Figuren Ellen
und Roman (Ellens in Berlin gebliebener Freund) aus dem fernen,
lärmenden Berlin zu berichten hat, das schrumpft er auf ein
anthropologisch annehmbares Maß zusammen: „Es dauert von Tag zu Tag
länger, von einem Ort an den anderen zu gelangen. Nicht, dass ich
langsamer geworden wäre. Ich bemerke bloß mehr und mehr
Kleinigkeiten, die mich aufhalten; Nebensächlichkeiten, die mich an andere
Nebensächlichkeiten erinnern.“
Das eigene Leben wird ihnen allen immer unbegreiflicher, die
zivilisatorischen Übereinkünfte sind für sie ausgehöhlt. Die Frage nach dem
Glück muss als Zumutung erscheinen, wo der Schlaf schon als
erstrebenswerter, seliger Zustand gilt. „Vogelfrei, im losen Glück“ sind
einzig und allein „zerrupfte Hühner, die nicht wissen, dass sie sterben, die
ganz und gar damit beschäftigt sind, Hühner zu sein“. Dem Menschen, vom
Bewusstsein seines Todes beschwert, bleibt demzufolge nur die Einübung
in den Gleichmut – das ist Epikur pur. Dass es am Ende gar noch einen
Toten gibt – einer der Freunde schießt sich mit Tanas Pistole aus Versehen
in den Oberschenkel –, auch dieser Höhepunkt an äußerer Handlung wird
bald von den unaufhörlichen Wellen des Gesprächs überspült.
Der Schweizer Matthias Zschokke, seit 1980 in Berlin lebend, hat ein
haltloses, bodenloses Buch geschrieben. Die langen Monologe voller
filmischer Slapstick-Episoden spannen sich über einen Untergrund tiefster
Melancholie, in dem die Jacht der Erzählgesellschaft geankert hat. Die
Unruhe, mit der die Verzweiflung, der Skandal des Alltags und des
Älterwerdens ertragen, ja sogar mit fatalistischer Zustimmung begrüßt
werden, stellt die eigentliche Provokation des Losen Glücks dar: die
Provokation als Plauderei auf der Jacht oder im Salon, die Katastrophe als
behagliche Kontemplation. Fin de siècle am Bielersee.
