
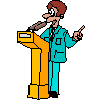
Ich kenne einen Professor aus jenen Tagen, als er noch keiner war. Er hatte erschreckend schiefe Zähne. Jede albanische Schindmähre hätte in ihm auf Anhieb einen Leidensgenossen vermutet. Und selbst der abgezehrteste Klepper aus der Bourbakiarmee hätte ihm am Futtertrog ohne Murren den Vortritt gelassen in der festen Überzeugung: dem armen Kerl geht es ja noch schlechter als mir, was für ein abscheuliches Gebiss!
Als ich ihn kennenlernte, hatte er die Angewohnheit, sich mit Begeisterung über andere lustig zu machen. Dazu rieb er seine Hände aneinander wie eine Fliege und entblösste grinsend seine schiefen Zähne. Eines Tages stellte er fest, dass die anderen sich mit fast noch mehr Begeisterung über ihn lustig machten. Das vergällte ihm seinen Spass, und er zog sich aus der Runde der Sich-lustig-Machenden zurück. Ach wissen Sie, sagte er, winkte mutlos ab und wurde Professor. Wenn er heute gefragt wird, wie es sich als solcher denn so lebe, steigt das alte Grinsen in sein Gesicht, er reibt sich wie früher kurz die Hände, verharrt, hebt die linke zierlich vor seinen Mund - eine Angewohnheit, die er längst hätte fallen lassen können, hat er sein Gebiss in der Zwischenzeit doch richten lassen - und sagt:
Ach wissen Sie . . . Eigentlich ganz gut. Ich würde sogar wagen, mein Dasein als ein rundum glückliches zu bezeichnen, wenn da nicht der Neid wäre, den zu schüren ich mich selbstverständlich hüte. Davon unabhängig ist ein Professorentitel wirklich etwas, das man unter gar keinen Umständen jemals wieder missen möchte. Ist man erst einmal einer geworden, kann nichts mehr schief laufen im Leben. Was für ein Vorteil beispielsweise gegenüber Leuten, die nicht wissen, wozu sie da sind, verstehen Sie? Wie zutiefst beunruhigend es für einen doch sein muss, morgens aufzustehen ohne zu wissen warum! Der Mieter in der Wohnung oben drüber steht auf und duscht sich, der Mieter unten drunter steht auf und macht das Radio an, also steht man selbst ebenfalls auf und . . . Ich weiss beim besten Willen nicht, was so einer dann tut. Als Professor hingegen weiss ich erquickenderweise jederzeit, was zu tun ist. Ich mache mich frisch, ziehe mich an und gehe in die Universität, wo schöne junge Menschen herumstehen und darauf warten, dass ich vor sie trete. Dann setzen sie sich hin. Ich will jetzt nicht zu breit werden in meinen Ausführungen. Was ich den jungen Menschen vermittle, würde zuviel Platz beanspruchen. Einfach ausgedrückt: ich erkläre ihnen, wie das Leben funktioniert. Das klingt, auf diesen kurzen Nenner gebracht, möglicherweise etwas zu allgemein, aber so ist es. Ich werde verlegen, während ich Ihnen meinen Alltag schildere. Lassen wir das.
Vor meinem Haus steht ein Fahnenmast. Zu Nationalfeiertagen hisse ich die Landesfarben. Am Abend sinke ich ins Bett. Vorher trinke ich Rotwein. Das sind Gewohnheiten, mit denen schon andere vor mir gute Erfahrungen gemacht haben. Ich bin froh, Erfahrungen nicht selbst machen zu müssen, sondern welche übernehmen zu können. Alles läuft wie geschmiert, wenn man sich an sie hält. Die meiste Arbeit in meiner Position bereitet es, recht zu behalten. Wenn ich ein Buch lese, denke ich darüber nach, was mir darin recht gibt. Das merke ich mir. Den Rest vergesse ich. Liege ich hinter meinem Haus auf dem Rasen und schaue in den Himmel, überlege ich, worin dieser mir recht gibt. Ein Kater, der oft vom Nachbargrundstück zu uns herüberkommt, gibt mir in nichts recht. Ich rufe den Nachbarn immer wieder an und dringe in ihn, er möge seinen Kater doch bitte bei sich behalten. Kaum lege ich den Telefonhörer auf, sitzt das Vieh schon wieder in unserem Garten und starrt mich an. Ich sage «unser» Garten: Ich habe eigene Kinder und eine Frau. Die Kinder gehen zur Schule und spielen Harmonium. Das mag auf den ersten Blick befremden, aber Harmonie wird in unserem Haushalt seit Generationen gross geschrieben. Ohne Harmonie wären wir nur halbe Menschen. Meine Frau ist zwölf Zentimeter kürzer als ich, das sieht im Zusammenhang mit mir harmonisch aus. Sie wollte auch etwas werden in ihrem Leben, ich habe vergessen, was es war. Jetzt ist sie meine Frau. Auf dem Weg dahin schaute sie mich manchmal an wie eine Ertrinkende. Sie meinte aber nicht mich, in welchem sie zu ertrinken wähnte, sondern das Leben ganz allgemein, das sich ihr gegenüber ihrer Meinung nach unangemessen gnadenlos gebärdete. Eine Zeitlang fürchtete ich, sie würde zusammenkrachen, so verlottert sah sie aus, wie von Ratten angenagt. Jeden Morgen standen ihr die Haare zu Berg, und die Augen waren schreckhaft weit aufgerissen. Irgendwann schickte sie sich in das Los, meine Frau zu sein. Seither geht es uns gut. Sie zieht sich an wie meine Frau, und ihre Augen haben jeden fiebrigen Glanz verloren; sie ruhen matt in ihrem Gesicht und saugen alles Ungereimte wie Zweifel oder Hoffnungen porentief weg. Man soll nicht negativ reden, auch nicht über die Vergangenheit, darum zurück in die Gegenwart. Meine Kinder machen mir Freude. Sie fragen, was ich zu beantworten weiss. In der Schweiz verdienen Professoren mehr als in Deutschland. Für grosse Sprünge reicht es in beiden Ländern nicht. Professoren bewegen sich darum eher auf hoppelnde Weise. Wäre ich nicht Professor geworden, wüsste ich heute beim besten Willen nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Einer meiner Jugendfreunde ist keiner geworden. Er läuft mir manchmal zu den unmöglichsten Zeiten über den Weg, beispielsweise morgens um viertel vor elf, weil er nichts anderes mit sich anzufangen weiss als herumzulaufen. Wenn wir uns so unverhofft begegnen, schauen wir uns argwöhnisch an. Wer nicht irgendwann in seinem Leben Professor oder sonst etwas Vernünftiges wird, aus dessen Tiefe weht einem an Werktagen der eiskalte Hauch der Sinnlosigkeit entgegen. Jeder baut sich sein Nestchen, polstert es aus, legt sich hinein, bessert nach, pickt Körner, aber wir wissen nicht, wie oder was singen. Ob mein Leben möglicherweise anders hätte verlaufen können? Eigene Kinder und die Universität verjagen Gedankenwolken, die sich über diesem Was-wäre-wenn-Themenkreis manchmal drohend zusammenbrauen wollen. Einer, der keine Frau, keine Kinder, keine Universität sein eigen nennt, der muss sich entsetzlich fragwürdig vorkommen, denke ich. Manchmal stürzt das Gesicht meiner Frau heute noch in sich zusammen, besonders häufig während der Semesterferien. Was unter den Trümmern dann hervorbleckt, das will ich lieber nicht beim Namen nennen. Es ist grauenvoll. Schnell zurück zu meinen Kindern, deren Gesichter noch nicht die Fähigkeit errungen haben, plötzlich einzubrechen. Wie viel Sinn hat es doch, welche auf die Welt gebracht zu haben!
Aargauer Zeitung, Aarau, 2o.1o.2oo1