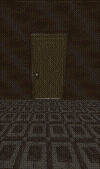|
Ein Autor des Stils: Matthias Zschokke
|
Matthias Zschokke, in Bern geboren und seit zwanzig Jahren in Berlin ansässig, erfindet
Theaterstücke, Romane, Filme und auch sich selbst.
Mitten im hektischen Treiben der neuen deutschen Hauptstadt ist der 47-jährige
Schweizer ein Fremder geblieben. Sein erster Roman, «Max», hat ihm 1982 den Robert-Walser-Preis
eingebracht - und eine an Walser erinnernde Eigenwilligkeit charakterisiert bis
heute seine Prosa («Der dicke Dichter», «Das lose Glück»). Seine Stücke («Brut»,
«Der reiche Freund», «Die Alphabeten») haben ihn nicht in die Liga der neuen wilden
Theaterautoren katapultiert, obwohl er manchen Preis für sie eingeheimst hat. Er
ist ein Autor des Stils. Fast zeitgleich präsentiert er nun ein neues Bühnenwerk,
«Die singende Kommissarin» (im Berliner Renaissance-Theater), und einen Geschichtenband,
«Ein neuer Nachbar».
Das Stück gehört nicht zu seinen besten Würfen, doch trägt die missglückte Uraufführung
zu dieser Beurteilung nicht unwesentlich bei. Im Zentrum des monologischen Abends
steht eine Kommissarin (Judy Winter) auf der Wache am Berliner Ernst-Reuter-Platz,
einst stadtbekannte Sängerin einer Band, nun fast vergessen. Es ist Silvesternacht.
Ein Reality-Radiosender befragt sie. Sie gleitet ab in Erinnerungen. Das eine oder
andere Chanson wird gesungen, eine Taube auf dem Gesims abgeknallt. Dann entfaltet
sich auf dem nächtlichen Videohimmel das grosse Feuerwerk, die Kommissarin prostet
sich selber zu, der Vorhang schliesst sich.
Zschokke geht es um das Authentische. Er insistiert auf die unmittelbar verstreichende
Lebenszeit. Und was, so fragt und gibt er zu verstehen, ist heute denn noch erzählenswert,
was überhaupt vom Leben, vom Theater zu erwarten, wenn nicht das, was eben gerade
auf Grund seiner Unausgefülltheit spannend ist.
Noch nachvollziehbarer als in der «Kommissarin», noch fühlbarer wird Zschokkes
Intention in seinem neuen Buch, «Ein neuer Nachbar». Unmerklich wird der Leser von
der Stimme eines ungenannten Erzähler-Ichs an die Hand genommen und durch ein nach
rhythmischen und melodischen Gesichtspunkten zusammengestelltes Mosaik von Prosastücken
geführt. Lebenszeugnisse und Selbstparodien des Schreibenden sind eingewoben in
eine Folge von Alltagsbeobachtungen. Manchmal wirkt das wie ein literarisches Tagebuch,
zumeist handelt es sich um ein fortlaufendes Selbstgespräch, an dem der Leser vergnüglich
teilhaben kann.
Der Autor versteht es, das scheinbar Bedeutungslose in Worte zu binden
Wiederum ist Zschokkes Thema das Aushalten des Alltäglichen, der Wahrheit der grausigen,
weil inhaltsleeren Wirklichkeit. Aus ihr steigen verzerrte Blasen, Fantasien und
Fantasmagorien auf, aber ebenso ernüchternde Betrachtungen über das Älterwerden,
den Tod. «Ich gehe gern umher, zwischen Häusern, über Land, an Küsten entlang»,
so lautet das Motto. Doch schon auf der nächsten Seite stirbt einer und verschwindet
spurlos, als wäre er nie gewesen: «So schnell geht das.»
Werdegänge, Laufbahnen, Durch-schnittskarrieren werden entrollt. Die verkorkste
Lebens- und Familienplanung eines Beamten entfaltet sich. Skurrile Figuren erscheinen:
ein Schauspieler, ein Sänger, der Dichter selbst. Er sitzt in einem «Büro» genannten
Raum jahraus, jahrein an einem Tisch, beheizt ein Öfchen, trinkt «Schwarutee». Wir
schauen ihm über die Schulter, wie er an eine Freundin, an seinen Verleger, an die
Genfer Briefe schreibt und verwirft, stets angespannt. Mittags wird pausiert, man
geht erfolglos Geräuschen, Tönen, Erscheinung nach im Quartier. Der kleine Mensch
kehrt ewig wieder. Zum Beispiel der neue Nachbar, der zwischen Tür und Angel haltlos
seinen Aufstieg vom Klempnersohn zum Unfallchirurgen, Knochensäger und Herrscher
absterbender und zerstörter Gewebe schildert. Rührend-klägliche, erbärmliche Erkenntnisse
werden da gezogen, Meta-phern schriftstellerischen Geschicks leuchten auf.
Das Feld, auf dem dies sich austrägt, ist die Stadt Berlin, die Zschokke voll gegenstandslosem
Begehren durchstreift. Seitenblicke werden ins Schweizer Seelenleben geworfen, das,
so steht da, sein Glück hinter einer servilen Neigung zum Unglück verbirgt.
Zschokke, im Kampf gegen verkehrte Sätze, Plappermäuler, die Gefallsucht und den
Lärm der Zeit, rät an entscheidender Stelle zur Kontemplation: «Schliesse das Fenster
beizeiten, lass Ruhe einkehren, leg dich hin.» Zu den Stärken des Autors gehört
es, das scheinbar Bedeutunglose und Vergängliche, wozu wir das Alltägliche einrechnen,
in Worte und Sätze zu binden, gleichsam als Impfstoff, Tablette, Finte gegen die
Unerträglichkeit und Unzulänglichkeit des Realen. Die letzte Zeile des Buches klingt
denn auch fast wie ein Sieg: «Das Glück ist nicht leicht in Worte zu fassen, doch
habe ich den Eindruck, es sei mir hiermit gelungen.»
"SonntagsZeitung", Zürich, 17.2.2oo2
54
Essays
Kulturkritik von Matthias Zschokke
Eine Besonderheit des Papiers in den Büchern vieler deutscher Verlage ist vor 15 Jahren dem italienischen Designer Franco Maria Ricci aufgefallen. Es hat ein aufgeblähtes Volumen, so dass die Bücher dicker wirken als sie wirklich sind. Uns Käufern ist jedoch bald die Kehrseite dieses Ködertricks aufgegangen, der suggerieren sollte, wir erhielten viel Buch fürs Geld. In unsern Häusern und Wohnungen, die ja keineswegs größer werden, beanspruchen unnötig dicke Bücher nämlich unnötig viel Platz. Beim Siegeszug der Bestseller made in USA ist ein zweites Phänomen zu beobachten gewesen. Romane und Sachbücher wurden tatsächlich immer umfangreicher, aus dem gleichen Kalkül, nur dass es diesmal vor allem von Autoren und ihren Agenten angewandt wurde - damit ihre Werke in den Buchhandlungen ins Auge sprangen, potentielle Konkurrenztitel aus den Regalen verdrängten und - weil sie in Massenauflagen billig hergestellt werden konnten - mit dem Eindruck zum Kauf motivieren sollten, wir bekämen für relativ wenig Geld eine Menge an Substanz. Da haben die Verlage sich mit ihrem mass marketing jedoch selber ein Bein gestellt. Der durchschnittliche Buchumfang der Schwerpunkt-Novitäten stieg von 1990 bis 1995 bei uns um rund vierzig Prozent an. Das bedeutet möglicherweise aber auch, dass wir vierzig Prozent weniger neue Titel lasen. Das wiederum mag noch andere Gründe haben - John Gielgud nannte sie beim Namen: «Ich war irgendwie verstört, als ich entdeckte, dass es mich zwei lange Wochen kostete, die mehr als 1100 Seiten eines Romans zu lesen. Ich fand den Roman viel zu lang, lax und ausufernd geschrieben, zügellos, unpräzise und bodenlos .» Nun gibt es da ein weiteres Problem und Phänomen. Denn es hat sich in der schreibenden Zunft «eine schnell wachsende Gemeinschaft von wild um sich schlagenden Dilettanten gebildet, die auf den Markt drängen und platthauen, was sich dort in altmodischer Geistigkeit und zurückhaltender Würde versucht zu artikulieren.» So umschreibt es Matthias Zschokke in seinem neuen Buch. Und er hegt - nicht zu Unrecht - die Befürchtung, dass ein Literatur- und «Kunst-zum-Anfassen-Trubel» ausgebrochen ist, in dessen Kirmes immer mehr «freie Schriftsteller» von Beruf und Berufung, um auf dem Buch- und Medienmarkt zu überleben, «aufs Karussell springen» und «davongewirbelt» werden. Das Dumme daran ist, dass wir auf diese Weise viel Literatur geboten bekommen, die nicht aus wahrem Können entsteht, sondern Mimikry ist. Sie resultiert aus falscher Anpassung an herrschende Kritikermeinungen und «Markt»-Tendenzen. Solche Bücher fordern uns nicht heraus. Solche Autoren wollen von uns nur bestätigt werden. Sie «sind auf Applaus aus». Sie sprechen die Leser nicht wirklich an, wecken keine neue Wahrnehmung unserer selbst und der Welt. Sie degradieren uns zu Claqueuren am Wegrand der «Route des Zeitgeists». Ich glaube, dass hier die Ursache liegt, warum die Lektüre von vielen Büchern immer häufiger einen schalen Geschmack der Enttäuschung hinterlässt. |
|
«Je älter ich werde», schreibt Matthias Zschokke, «desto mehr missfallen mir Äußerungen, die mir zu Gefallen gemacht werden. Ich mag keine Literatur, die mir gefallen will, keine Kunst, die mir gefallen will, keine Menschen, die mir gefallen wollen. Ich fühle mich von ihnen auf unangenehme Weise belästigt und eingeengt.»
In unserer Sprachgegend bekommen - anders als in England und sogar in den USA - bedeutende Schriftsteller in Zeitungen zunehmend seltener Platz, um sich über ihre Erfahrungen mit neuer Literatur zu äußern. Das tut Matthias Zschokke in seinem Buch.
Es gibt durchaus Kritiker, die eine unabhängige, fundierte Orientierung über die neue Literatur ermöglichen. Wenn Schriftsteller selber über Bücher schreiben, ist das wieder etwas anderes. Sie zeichnet zweierlei aus, was Kritikern gelegentlich abgeht: ein untrügliches Gespür für die innere Wahrheit literarischen Schaffens und eine andere, vielleicht direktere Beziehung zum Lesen und damit zu den Lesern, für die der Kritiker als Vermittler tätig sein muss. Zschokke verfügt über beides.
Matthias Zschokke ist ein bedeutender Autor. In Deutschland wird er unterschätzt, weil er Schweizer ist und die Schweizer Literatur zur Zeit keine große Konjunktur hat. Und in der Schweiz scheint er heute zu wenig beachtet, weil er seit langem in Berlin lebt. Sein neues Werk ist eine Trouvaille: in den Essays ein Kompass zum Lesen gegenwärtiger Literatur; in den Reportagen ein Blitzlicht, das den Zustand der gegenwärtigen Kultur erhellt; in den Erzählungen selber - essenzielle Literatur in hervorragender Verdichtung. Gerhard Beckmann
Matthias Zschokke: Ein neuer Nachbar. Meridiane 36, Ammann, 217 Seiten,
Fr. 36.90 Da
sich die heutige Literatur vorwiegend mit der Erscheinung der Dinge
auseinandersetzt, hat sich zunehmend der Stand des Dichters gesenkt. Mit
Matthias Zschokke sattelt ein gar unorthodoxer, selbstbewusster Streiter sein
Pferd, der dem Leser sein Menschdasein nicht vorenthalten möchte, aber die
einstmals hochgeachtete Stellung seines Berufs zu verteidigen scheint. Sein
Buch mit dem Titel „Ein neuer Nachbar“ besteht aus 29 eigenartigen Erzählungen,
Geschichten, Aufsätzen und Briefen, die buntgemischt durcheinander liegen und
daher schwierig in einen Rahmen zu setzen sind. Rund die Hälfte davon sind
Erstveröffentlichungen. Grob gehandhabt ist man versucht, das Buch in zwei
Teile zu zerlegen: Der
erste Teil trägt ausschliesslich fiktive Texte an einen heran, denen kaum
inhaltliche Gemeinsamkeiten abzugewinnen sind, einmal leicht und einfach
gekleidet, einmal kompromisslos und schwer verständlich erscheinen können.
Doch alle zeichnen sie sich durch eine gewisse Verspieltheit aus; das Verlieren
im Bau der Assoziationen, bis zum kleinsten Detail, zum äussersten Punkt des
Erfahrungsnetzes, um sich von dort aus wieder ins Ausgangsgeschehen zu begeben
und dieses in einem völlig neuen Licht erkennen zu lassen. Meisterlich
gehandhabt, spannend zum Lesen. Die Hauptfiguren variieren zwischen
autobiographischem Ich und unscheinbaren Persönlichkeiten, die erst bei näherer
Betrachtung interessante Hintergründe entblössen. Speziell erwähnt werden
muss das ganz und gar aus der Reihe tanzende „Sommer“, welches dermassen
widerwärtig und absurd wirkt, dass ich, im Gegensatz zu den anderen Texten, am
Wirklichkeitsbezug des Textes zweifle. Die Handlung beschreibt, wie eine
wahrscheinlich männliche Person seinen Begleiter auf sadistische Art und Weise
auf dessen Fettleibigkeit aufmerksam machen will und dessen Zuneigung zu ihm
aufs Äusserste prüft. Der
zweite Teil beinhaltet Stellungnahmen zu diesem und jenem, führt sehr
detailliert in die Gedankenwelt des Autors und hilft daher nicht selten ein
besseres Verständnis der vorangegangenen Texte zu entwickeln. Der Standort
Berlin wird zum zentralen Thema, bis der Leser dieses nur noch zu entkernen
braucht, um den Arbeitsplatz des Autors vor sich sehen, seine Inspirationen
nachempfinden zu können. Seine Vorlieben, seine Zweifel und seinen Protest
vermag man bis zu ihrer Entstehung auf diese Räumlichkeiten zurückzubeziehen. Kritisch
äussert sich Matthias Zschokke allemal gerne, doch ohne je den Respekt und das
Ziel der Menschlichkeit zu verletzen. So berührt seine Liebesbezeugung für
sein Vorbild, den Schweizer Dichter Robert Walser (1878-1956) dermassen, dass
man sich innig zu wünschen beginnt, Walser lesen zu lernen. Zschokke
distanziert sich aber von der Walserschen, wie er sagt, „bis zur
Selbstverleugnung durchgehaltenen Demutsmimikry“, und gibt sich aufrecht der
Hinterfragung seiner Erscheinung hin: „..., einer, der sich sein Leben lang
nur immer darum gekümmert hat, Ballast abzuwerfen, nichts als Ballast
abzuwerfen, um in höhere Sphären zu gelangen, während die Luft im Ballon kälter,
das Gas knapp wird. Einer, der weiterhin Sand rieseln lässt, nicht steigt,
nicht sinkt, der flach dahingleitet, knapp über dem Boden der Realität, den
Alltag sehend, die Mauern, die Furchen, die Schrecken der Banalität, der
offensichtlich zu zaghaft abwirft, um zu steigen, der wohl insgeheim die dünne
Luft weiter oben fürchtet, der fein säuberlich immer nur gerade so viel
hinunterwirft, dass er nicht aufschlägt, aber auch so wenig, dass es ihn nicht
in die Sterne heben kann.“ Ab und zu gelingt Zschokke selbst ein durch und
durch Walserischer Satz. Matthias
Zschokkes Werk hat mich tief beeindruckt. Mir stellt sich die Frage, wie jemand
wesentliche Lebensinhalte so furchtbar schön in so unheimlich einfache
Wortgebilde fassen kann. Einer, der weder alt noch weise ist, der gar der gegenwärtigen
schreibenden Zunft entstammt, welcher ich diese Gabe in keiner Weise abgefordert
noch zugestanden hätte. Schlussendlich darf diese Rezension aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Zschokke findet, der ihn finden muss.
Wynental Suhrental «Ein neuer Nachbar» in Gontenschwil GONTENSCHWIL · Matthias Zschokke kehrte
für eine Lesung zu seinen Wurzeln zurück Anna Verena Hoffmann Sax hat am Sonntag die Tore des Schlösslis für eine Lesung geöffnet. Der gebürtige Berner und nun in Berlin lebende Matthias Zschokke las auch aus seinem neusten Buch «Der neue
Nachbar». «Ich weiss nicht, ob das interessant ist, aber in meinem Pass steht als Heimatort Gontenschwil», antwortet der Schriftsteller bescheiden auf die Frage nach seiner Herkunft. Einige der 25 Besucher kamen eigens an seine Lesung ins Schlössli, um ihre
Familienbande bestätigt zu wissen. Über die Heimkehr in die Heimat liest Zschokke auch als Erstes. Simon kehrt als Erwachsener an den See seiner Kindheit zurück. Aus der zuerst geografischen Umkehr zu seinen Jugenderinnerungen. Innerlich übervoll
verbringt er die Nacht in der örtlichen Gaststätte, um am nächsten Tag zu erfahren, dass während seines Aufenthaltes ein Sportflugzeug abgestürzt sei. Die Insassen mit Namen Vogel seien sofort gestorben. Vogel hatte auch ein Junge aus Simons Schulzeit
geheissen, der sich mit Kringeln aus der elterlichen Fabrik Freunde zu kaufen versuchte. Mit eindringlichen Worten beschreibt Matthias Zschokke den Zusammenhang zwischen diesem Vogel und Simon, den merkwürdigen Handel um Simons Badehose. Beklemmend genaue Bilder Matthias Zschokke liest, ohne aufzublicken, ruhig. Seine Hände zeigen seine Beteiligung am Geschriebenen. Hinter ihm hängen Seerosengemälde von Heinz Goetschy, im Vordergrund lässt er seine eigenen Bilder entstehen. Und diese mit beklemmender
Genauigkeit, sodass man selber fühlt, wie es wäe, im Schlamm des Sees auf eine Seeschlange zu treten. «Hier ist es ja still wie in einer Kirche!», sagt er und blickt vom Buch auf. Verschnaufpause für die Zuhörer, Gelächter. Er sei am Tag vorher an einer
Klassenzusammenkunft gewesen, erzählt der Schriftsteller als Einleitung zu seiner zweiten Geschichte. Und es wird bald deutlich, was er damit sagen wollte. Sein zweiter Text ist aus dem vergriffenen Band «Der dicke Dichter», ein Text über Menschen
mittleren Alters. Keine Erzählung, eher eine Studie eines Lebensalters mit pointierten Beobachtungen, die genauso zum Schmunzeln wie zur Selbsterkenntnis anregen. Mit Sinn für Poesie verfolgt Zschokke einen Satz oder einen Gedanken bis zum Ende, kostet
ihn aus. Das wird auch in den beiden Erzählungen aus seinem neusten Werk, «Ein neuer Nachbar», deutlich. In der ersten beschreibt er einen Professor, der durch sein Amt weiss, was er zu tun hat und was recht ist. Eine Geschichte, die zeigt, wie Menschen ihrem
Leben krampfhaft Sinn zu geben versuchen. Um das Sterben geht es in der letzten Geschichte «Da Sie gerade vom Sterben reden». Zwei Bekannte tauschen ihre Vorstellungen vom Tod aus und kommen schliesslich auf Kerne zu reden, welche das Leben und die
Literatur ausmachen: «Jahrtausendliteratur ist immer einfach.» (sga)
"DAS BUCH/ Bücherpick", Urtenen, März 2oo2
Ode an den
neuen Nachbarn
Zu fesselnd sind Zschokkes karge, aber treffsichere Analysen menschlicher Macken, zu elektrisierend seine scheinbar leidenschaftslosen und in ihrer spitzen Formulierung doch so packenden Plädoyers für den kommunen Durchschnittsmenschen im Schweizerland wie in Berlin. Und immer wieder verblüfft der Scharfblick, mit dem er gesellschaftliche Spiele entschlüsselt, sie mit behänder Leichtigkeit, oft sehr sensibel aus weiblicher Sicht, skizziert. Etwa in der Erzählung «Balz», die, nicht ohne Wärme für Antihelden und ihre Schwächen, stures patriarchales Bünzlitum dokumentiert, das sich in seiner Selbstdarstellung so ahnungs- wie schonungslos entblösst - und damit auch das für die Partnerin des Protagonisten tödliche Beengende, eine gnadenlose Falle, der sie nicht entgeht. So blitzt gleichfalls im Stück «Der Professor» das stumme, unverstandene Leiden bedrängten Frauseins auf im selbstgefälligen Monolog eines Egomanen, der die Erde zu einer, seiner Scheibe macht, auf der nichts existieren darf als seine arroganten Ansichten dieser Welt. Tod, Triebe, Liebe - Themen, die sich wie ein roter Faden, launisch oszillierend, durch die Lektüre ziehen und auch im «Brief eines Katzenfreundes» in individueller Prägung zu finden sind, hier im Spannungsfeld neurotisch verzerrter Bigotterie und der menschlichen Unfähigkeit einer würdigen Begegnung mit der Natur. Sind diese drei Erzählungen repräsentativ für die Fülle, die der neuste Band des Autors enthält? Der Höhepunkte sind viele, einige Facetten wurden präsentiert. Doch wie immer man gewichten mag, eines steht fest: Die Bilder, die Matthias Zschokke schafft, sie haben ihre ganz ureigene Kraft.
"Schaffhauser Nachrichten", Donnerstag 30. Mai 2002
Poetische Sprachbilder
*** Ohne Punkt und Komma spricht der neue Nachbar über seine Arbeit als Chirurg, über den Krieg, über Gott und die Welt. Dabei wollte ihm der Ich-Erzähler doch nur eine Flasche Wein zum Einzug bringen; jetzt drückt er halt alle paar Minuten den Schalter für das Flurlicht und hört zu. Derart skurrile Situationen sind die Stärke des Schweizers Matthias Zschokke, er findet in seinen 29 Prosastücken Sprachbilder von hoher Poesie, die er scheinbar emotionslos in Geschichten verpackt. Geht es darin um Äusserlichkeiten, überströmt Zschokkes Formulierkunst, bei Existenziellem hingegen bleibt die Sprache karg. Und die Erzählungen wirken immer wie die Suche nach einer Utopie des Simplen.
(gl)
"Facts", Zürich, Nr.22/ 3o.5.2oo2
Die feine Profanierung der höheren
Sphären
Philippe Gaudin
Der Autor ist Schüler der BERNER MATURITÄTSSCHULE FÜR ERWACHSENE. Die Besprechung erschien als Internetveröffentlichung (http://www.kl.unibe.ch/sec2/bme/) im Rahmen von "Klassen-Aktivitäten".
Spiel im Absurden
1981 erhielt der Schweizer Schriftsteller Matthias Zschokke den Robert Walser-Preis der Stadt Biel und des Kantons Bern. Zwanzig Jahre später dankt er seinem großen Landsmann mit einer kleinen, aber schönen Notiz: "Er ist ein Dichter, eine Lichtung ganz für sich allein in der Literatur. Er schreibt ausschließlich für sich selbst, fürs Schreiben, fürs eigene Leben, um den Moment auszuhalten und nicht in den Sekunden unterzugehen. Er verfolgt keine Strategie, keine Taktik." So liest man in Zschokkes Buch "Ein neuer Nachbar", das zur Hälfte aus in über zehn Jahren verstreut publizierten Gelegenheitsarbeiten und zur anderen Hälfte aus neuen Texten besteht - Disparates, in dem man ein wenig schmökern kann.
Die meisten Texte verschieben existentielle Normalität spielerisch ins Absurdistische, jonglieren dabei gern mit Klischees, verfallen ihnen aber gelegentlich auch. Kunst und Leben, das deutet auch die Walser-Notiz an, werden gern in einen Aggregatzustand gespiegelt. Es scheint, als könne sich das Leben, wie es hier erfahren wird, gar nicht dagegen wehren, Kunst zu werden. Zum Beispiel in der Titelgeschichte, die hier erstmals veröffentlich wurde: Ein neuer Nachbar zieht ein, der Erzähler will ihn mit einer Flasche Wein als neuen Nachbarn begrüßen; der öffnet die Tür, entschuldigt sich, daß er ihn nicht hineinbitten könne, und beginnt ihm unter der Tür seine ganze merkwürdig verschrobene und groteske Lebensgeschichte zu erzählen - eine Geschichte, die sofort aus ihrem normalen Rahmen in die erzählerische Groteske gekippt wird. Und aus der so mancher heute eine ganze Novelle gemacht hätte.
HEINZ LUDWIG ARNOLD
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.11.2002, Nr. 259 / Seite 34
Bieler Tagblatt vom 12.09.2003, Ressort Kultur
Die Neugier auf den Mitbewohner
Alles spielt sich danach zwischen den beiden Wohnungstüren ab. Die Ich-Person erlebt dabei die vielleicht längsten Minuten ihres Lebens. Das wiederholte Drücken auf den Lichtschalter wird dabei für sie zum erlösenden Faktor, verschafft ihr kurze Momente der Entspannung. Vorherrschend aber bleibt die Reue über ihre Spontaneität, die sie die wenigen Schritte zur Tür der andern Wohnung hat unternehmen lassen aus einem Gefühl heraus, wenigstens ein paar Worte mit einem andern Menschen zu wechseln. Ein paar Worte...
Matthias Zschokke kennt Stadt und Land, das Grossräumige und das Kleinstädtische, die Idylle vielleicht sogar. Er lebt seit 1980 in Berlin, arbeitet als Autor und Filmemacher. Mit dem Seeland ist er bestens vertraut, ist doch der 1954 in Bern Geborene als Zwölfjähriger mit seiner Familie nach Ins gezogen und in Biel ins Gymnasium gegangen.
Auch danach gab es Verbindungen zu dieser Stadt: 1981 wurde er mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet, eine von mehreren Ehrungen, die er in der Schweiz und international für sein Gesamtwerk - darunter Dramen und Romane - erhielt. Zschokke ist weiter Theatertexter und ist mit der Bühne auch als Schauspieler vertraut.
Zum Stil von Zschokkes Vorgänger gehörte neben der Bildhaftigkeit auch die Fähigkeit, das Grosse mit dem Kleinen zu verbinden, das Übergeordnete von etwas scheinbar Unbedeutendem herzuleiten. Das scheint auch Walsers literarischem Nachfahren zu gefallen: Wenn er in einem Interview festhält, er lebe auch deshalb in Berlin, weil er hier ein «beinahe stechmückenfreies Schlafzimmer» habe, so ist dies die Bagatelle zur Lebenskunst erhoben.
Aargauer Zeitung / MLZ; 2003-09-16; Seite 1