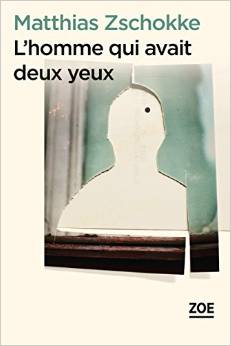Matthias Zschokke schreibt vom scheinbar Alltäglichen, entdeckt daran das Einzigartige, Schöne, Traurige und Komische und erzählt ganz nebenbei eine diskrete Liebesgeschichte.
Tragisch oder komisch? Abgründig oder banal? Alltäglich oder außergewöhnlich? Der Roman balanciert zwischen diesen Gegensätzen ebenso wie sein Protagonist, von dem man nur gerade erfährt, dass er zwei Augen hat und eine Nase, und der in einer Selbstbeschreibung von sich sagt: »Ich komme im Mantel, in einem sandfarbenen, und in der linken Hand halte ich voraussichtlich einen kleinen sandfarbenen Koffer. Ich bin durchschnittlich groß, habe durchschnittlich kurzes, sandfarbenes Haar, und rechts von mir wird eine Frau gehen, die etwa ein Kopf kleiner ist als ich, und die Sie sich der Einfachheit halber am besten auch gleich sandfarben vorstellen- wir werden einander bestimmt nicht verpassen.«
Ob in den Cafés und auf den Straßen, beim Zusammentreffen mit Fremden und Bekannten, ob auf Reisen oder zu Hause bei der Frau, die der Mann mit den zwei Augen vor vielen Jahren beim Chorsingen kennen und lieben gelernt hat, ob bei Rosaura, die ihm in ihrem Etablissement die merkwürdigsten Freuden zuteil werden lässt: Zschokke ist ein Meister darin, die Dinge und Ereignisse im Erzählen zu drehen und zu wenden, bis sie in einem fremden Licht ihre Selbstverständlichkeit verlieren und uns staunen machen.
Matthias Zschokke richtet in seinem Roman „Der Mann mit den zwei Augen“ seinen düsteren und scharfen Blick auf die Leere modernen Lebens.
„Wer sich erst einmal zu fragen beginnt, warum er dies oder jenes tut in seinem Leben, der ist bald allein.“ Der „Mann mit den zwei Augen“, der so denkt, weiß, wovon er spricht. Nachdem seine Katze und selbigen Tags seine Frau verstirbt, sagt er seinem kleinen und grauen Leben ganz Adieu. Einen Namen gibt Zschokke ihm nicht.
Gegen Ende des Buchs soll er „der Einfachheit halber bis auf weiteres Philibert heißen“. Der Mann, das sind viele. Er hat einen „sparsamen Gesichtsausdruck“ und eine „sandfarbene“ Erscheinung. Der mittelgroße 56jährige Gerichtsreporter verliert nicht nur Katze und Frau, sondern auch seine Stelle, die sich nicht mehr rechnet, und seine Wohnung „in der Hauptstadt“, die er nicht mehr bezahlen kann. Freunde hat er nicht (mehr). Dazu war sein Blick auf das Leben zu misanthropisch, zu lakonisch, zu klar: „Wenn das, was du zu sagen hast, nicht schöner klingt als die Stille, dann schweig.“ Der Mann verstummt immer mehr.
Was macht so jemand, dem auch noch die letzten Fäden zerreißen? Zschokkes Held geht in die Provinz. Dort sitzt er am Fenster der Ausländerpension oder am Tresen der nebulösen Bardame Rosaura und blickt auf sein Leben zurück: die Ehe mit der Frau, die er siezte, unlustige Geburtstage in Straßburg, die Öde der Gerichtsschreiberei, Friseurbesuche. Zschokke versteht es meisterlich, die großen Nein-Sager der Literatur zu zitieren und in Alltagsszenen zu zaubern, dass sich einem die Nackenhaare sträuben. Über sie hinaus kommt er nicht.
Dem Friseur gegenüber zeigt der Namenlose, wie Reflexion geht: „Eigentlich wollte ich bloß ein wenig nachschneiden und den Nacken ausputzen lassen. Ungefähr so möchte ich auch nach ihrem Eingriff noch ausschauen, dann allerdings weniger mitgenommen und wieder mehr in mir selbst ruhend, abgeklärter.“ Ein Haarschnitt als Heilsversprechen. Das sind wir.
So witzig bis leutselig Zschokkes Sprache wirkt, so brutal durchschaut sie die Isolation des Einzelnen. Auf „Sozialsysteme“ jenseits des Thekenrandes verlässt der ruinierte Philibert sich nicht. Als sein Plan, mit den Freimaurern sein Glück zu machen, wie alle anderen Pläne scheitert, kündigt er Rosaura an, sich aufzuhängen. Man möge „Kutschi“ mit seinen starken Nerven schicken, ihn abzuschneiden. Rosaura ist brutal genug zu sagen, was sie denkt: „Sie sind da und Sie sind vollkommen überflüssig“. Dann reicht sie 500 Euro rüber - der Mann beginnt, Gläser zu spülen. Wohltat wird zur Lebensqual. Nicht Dostojewskijs Kirillow mit seiner Idee des Suizids als Lebensbewältigung behält das letzte Wort, sondern Büchners Satz über Lenz: „So lebten sie hin.“
[tnr]: "Frankfurter Neue Presse", 7.6.2o13
In seinem Roman "Der Mann mit den zwei Augen" serviert Matthias Zschokke keine laue Suppe, sondern ein ziemlich raffiniertes Gebräu.
Eine Geschichte möchte Severinchen hören, "aber nicht so eine laue Suppe, daß mir vom Anhören die Ohren welk werden. Eine Geschichte, die auch Amerika versteht, etwas Kräftiges." Derlei freilich kann "Der dicke Dichter" in Matthias Zschokkes gleichnamigem Roman von 1995 nicht liefern, schreibt er doch den Wünschen seiner Freundin entgegengesetzte Bücher: In denen "soll nichts geschehen, die Zeiten sind Zeiten, mehr nicht, die Geschichten folgen eine brav hinter der anderen, manchmal geht ihnen die Luft aus, kleine Geschehnisse, Anekdoten, Zeug".
Mit dieser Poetologie fügt er sich in die Folge der Künstlerromane, wie sie der 1954 in Bern geborene und in Berlin lebende Erzähler, Theaterautor und Regisseur Matthias Zschokke seit seinem Debüt "Max" (1982) in immer neuen Variationen entwickelt, wobei er mit seinem dicken Dichter nicht nur das Programm, sondern auch die Arbeitssituation teilt: Beide feilen in einem Büro in einem ehemaligen Berliner Fabrikgebäude an ihrer unamerikanischen Literatur. Zschokke sieht sich in einer Traditionslinie, die von Melvilles "Bartleby" über Robert Walser zu Wilhelm Genazino führt, dem er in seinem zuletzt erschienenen, sehr erfolgreichen Briefroman "Lieber Niels", einer 760 Seiten starken Sammlung von E-Mails, huldigt. Dass er sich auf Augenhöhe mit dem Bewunderten bewegt, beweist der neue Roman, in dem uns vieles bekannt vorkommt. Auch dessen Held hat den bekannten Büroverschlag gemietet, nur dass dort keine Literatur entsteht, sondern Gerichtsreportagen, mit denen sich der Protagonist mühsam über Wasser hält. Viel mehr erfahren wir nicht von diesem "Mann mit den zwei Augen" – der Titel legt unmissverständlich nahe, dass wir es mit einem Menschen von erheblicher Banalität zu tun haben. So beschreibt sich dieser Mann ohne nennenswerte Eigenschaften gegenüber Dritten als Muster des Unscheinbaren: "Ich bin durchschnittlich groß, habe durchschnittlich kurzes, sandfarbenes Haar, und rechts von mir wird eine Frau gehen, die etwa einen Kopf kleiner ist als ich, und die Sie sich der Einfachheit halber am besten auch gleich sandfarben vorstellen".
Natürlich hätten wir es nicht mit einem Zschokke-Roman zu tun, ginge es wirklich einfach zu: Bei aller sandfarben angetäuschten Langeweile ist die Hauptfigur eine schillernde Persönlichkeit. So stellt sich heraus, dass seine Begleiterin und er lange Jahre ein Paar waren, was beide aber nicht von einer wunderlichen Distanziertheit abhielt: "Sie waren irgendwann zusammengezogen. Hätte man sie gefragt, wann genau und aus welchem Grund das geschehen war, hätten beide verlegen geschwiegen und mit den Schultern gezuckt." So spricht der Mann stets von "der Frau, mit der ich jahrzehntelang zusammengelebt habe". Fest steht, dass zu Beginn der Geschichte zuerst die Katze der Frau stirbt, bevor sich diese das Leben nimmt, worauf der Mann die gemeinsame Wohnung verlässt und in eine Stadt namens Harenberg reist, in der er regelmäßig das Lokal einer gewissen Rosaura aufsucht, einer Wirtin und Puffmutter, die den Gast stets "für einen anderen" hält, aber gern mit Rat und (sexueller) Tat als Trösterin zur Verfügung stellt. Und des Trostes bedarf der einsame Mann: Seine Geschichte ist eine diskrete Liebesgeschichte, die von Verlust und der Schuld versäumter Nähe handelt.
Wie alle Romane Zschokkes ist auch dieser eine verspielte Versuchsanordnung, in der Haltungen, Beobachtungen, (sprach-)philosophische Reflexionen ein erzählerisches Medium finden, das kaum greifbar ist, aber just deshalb den komplizierten Lebensverhältnissen gerecht wird. Da geht es melancholisch zu, wütend, sarkastisch, oft frönt Zschokke einer absurden Komik, die exquisite sprachliche Juwelen gebiert, etwa das Bild eines traurigen älteren Herren, dessen Gesicht "an eine alte Ziege erinnerte, die keine Tücken mehr kennt". Severinchen würde diese tückische Literatur wohl nicht gefallen. Mag sie die kräftigen amerikanischen Suppen auslöffeln, wir halten uns an Zschokkes Zeug.
"Badische Zeitung", Freiburg, 9.2.2o13
Matthias Zschokke hat mit «Der Mann mit den zwei Augen» einen tollen Jedermann-Roman vorgelegt - destilliert
aus seiner giftigen Galle.
Alexandra Kedves
Welchen Luxus er sich leistet? «Keine sozialen Kontakte zu pflegen.» So lautet die Antwort des schweizflüchtigen
Heinrich-Zschokke-Urururenkels Matthias Zschokke, die er dem Berner «Bund» vor ein paar Wochen gab. Und man glaubt
ihm aufs Wort. Denn dass der Wahlberliner seinen Zeitgenossen an guten Tagen als mürrischer Melancholiker begegnet und
an schlechten als brüllender Berserker, ist seit der Veröffentlichung seiner frustrierten E-Mails aus den Jahren 2002 bis 2008
(«Lieber Niels», 2011) kein Geheimnis. Nett ist das nicht, aber das macht nichts: Nettigkeit ist nun mal kein Quell guter
Literatur; aus einer angeschwärzten Grundstimmung dagegen können, gekoppelt mit einem scharfen Auge und einer scharfen
Zunge, wunderbar pointierte Panoramen entstehen. Und ebendies gelingt auch im neuen Buch des 1954 in Bern geborenen
Schriftstellers und Filmemachers.
Zschokkes «Mann mit den zwei Augen» - sein Jedermann - tut wenig, beobachtet viel, kommentiert noch mehr. Die Frau, mit
der er jahrelang Bett und Tisch teilte und die er trotzdem siezte bis zu ihrem Tod, hat sich das Leben genommen; und sein
eigenes scheint sich irgendwie in läppischen Beschäftigungen und Begegnungen, ja, zu verläppern. Also gibt der 56-Jährige
seinen Job als Gerichtsreporter auf, packt den Koffer, nimmt sich vor, niemals mehr jemanden zu treffen, und zieht aus der
Kapitale hinaus in eine Stadt mit Fluss, aber ohne Gesicht, in eine billige Arbeiterpension. Dort fantasiert er ab und an von
seinem Freitod. Doch Suizid ist zu kompliziert, und am Ende sieht man ihn mit einer halbseidenen Barbekanntschaft hinterm
Tresen stehen und Gläser spülen. «Und so lebten sie hin», heisst es am Schluss, und frei nach Büchners Lenz ist Zschokkes
Weltverächter durch den ganzen Roman unterwegs. Er lebt dahin oder eher: Er stirbt dahin, Stück für Stück, gleitet langsam
aus dem Leben, je hellsichtiger er draufschaut. Und das ist auch schon die gesamte Handlung vom «Mann mit den zwei
Augen», die so unbarmherzig auf sich und den Rest der Welt blicken.Was zählt, ist das Erzählen selbst. Es springt rückwärts
und vorwärts, kramt in Erinnerungen, holt Episoden mit der toten Geliebten («der Frau, mit der er die Wohnung teilte») hervor
und kommt stets selbstkritisch daher - und dennoch so leicht, als gebe ein trauriger Flaneur seine Lieblingsanekdote zum
Besten. «Der Mann mit den zwei Augen» ist zu unsentimental für ein «Bonjour tristesse», aber zu verbittert für flockige
Taugenichtserei. Anders gesagt: So elegant wie in dem mittlerweile mit einem der ersten Eidgenössischen Literaturpreise
prämierten Roman gerät negativ grundierte Nüchternheit selten und so abwechslungsreich wie hier stagniert es sich gern. Es
ist, als male und monologisiere einer an die grauen Wände seines Seelenkerkers kleine Eisblumen.
Schlechte Menschen, arme Welt
Freunde hat der Mann keine, «aus Angst davor, dass sie ihm weggenommen werden könnten»; Hunde kommen ihm nicht
mehr ins Haus, seit sein vierbeiniger Gefährte totgefahren wurde - eine in knochentrockener und knallharter Ausführlichkeit
geschilderte Episode. Und dass er seine Mitbewohnerin - wohl - liebte, wird ihm erst lang nach ihrem Tod klar. Kurz: Die Welt
ist arm, der Mensch ist schlecht - besonders der Vermieter, dieser Spekulant -, und es klingt ein wenig, als ob Shakespeares
galliger Jacques aus «Wie es euch gefällt» mit einer kafkaesken Beamtenfigur wie dem Landvermesser Hand in Hand durch
die Gassen ginge. Der Mann identifiziert sich denn auch mit Kafkas Käfer Gregor Samsa: «Ekel und Wut über sein tägliches
Leben, das er nicht verstand, gärten in seinem Innern», meint er über Gregor - und über sich selbst.
Selbst das Schreiben spendet keinen Trost. Unser Mann in Berlin komponiert beispielsweise ausgefeilte empörte Briefe ans
Gericht (wegen der Mieterhöhung) oder protokolliert seine wilden Ritte durch die Literatur; und konstatiert doch ständig sein
Versagen und seine Langweiligkeit. «Der Stumpfsinn, der aus meinem Maul quillt, ist, je älter ich werde, desto unerträglicher»,
lässt er einen Bekannten wissen; und er leidet «unter der Sucht, über alles und jeden schlecht reden zu müssen». Wir
hingegen haben unsere Freude daran. Denn so schonungslos legt keiner unsere Schwächen frei: diesen Ennui, der uns so oft
aus dem Spiegel entgegenschlägt, diesen Narzissmus, der uns über Nichtigkeiten hadern lässt, dieses Gefühl der Einsamkeit,
das uns manchmal mitten im Gewühl des Alltags überfällt. Nur dann, wenn der Mann die Künstlermisere beklagt, die
Dumpfheit der Mitmenschen, die den Wert kreativer Arbeit nicht begreifen, rutscht das Buch bisweilen ins Bemühende ab und
mitten hinein ins Gejammer und Gemecker aus «Lieber Niels». Über weite Strecken jedoch fühlen wir uns ertappt,
repräsentiert und schlank formuliert: Da lebt einer unsere drögsten Seiten aus, da werden unsere fiesesten Feindseligkeiten
Fleisch, und unsere dämlichsten wie klügsten Weltzersetzungsorgien gewinnen Form und Gestalt - und haben eine
Geschichte, eine griffige, geschmeidige Geschichte.
"Tages-Anzeiger", Zürich, 2.2.2o13
Matthias Zschokke ist einer der listigsten Beobachter unserer Tage: Jetzt hat er mit "Der Mann mit den zwei Augen" einen Abenteuerroman geschrieben.
Für den Erzähler in Matthias Zschokkes neuem Roman ist Harenberg der schönste Ort der Welt. Hier hofft er, endlich tief und ruhig schlafen zu können und von sich als sehr jungem Menschen zu träumen. Und in gewisser Weise erfüllt er hier den letzten Willen einer Frau, die er, wie er erst rückwirkend erkennt, geliebt hat. Gesprochen haben die beiden selten miteinander, obwohl sie jahrzehntelang in einer Wohnung miteinander lebten. Aber weder er noch sie spürten das Bedürfnis, etwas über die Gefühle und Leidenschaften des anderen zu erfahren, noch wollten sie wissen, wie der Partner seine Tage verbringt. Es genügte, manchmal nebeneinander am Fenster zu stehen, ganz ruhig, wie man neben einem Hund steht, zu dem man Vertrauen gefasst hat, und nach draußen zu schauen - im Rückblick erscheinen ihm diese Momente als vollkommen glückliche.
Neben Wilhelm Genazino ist Matthias Zschokke der listigste und böseste Beobachter unserer Tage. Beide sehen die scheinbar banalen Details unseres Alltags als tückische Rätsel und begegnen ihnen mit empörter Melancholie, bildhaftem Witz und einer suggestiv-lakonischen Sprache. So ist der Held in Zschokkes neuem Roman, eben "Der Mann mit den zwei Augen", naturgemäß ein nach außen hin unauffälliger Zeitgenosse: "Ich komme im Mantel, in einem sandfarbenen, und in der linken Hand halte ich einen kleinen, sandfarbenen Koffer. Ich bin durchschnittlich groß, habe durchschnittlich kurzes, sandfarbenes Haar ... - wir werden einander bestimmt nicht verpassen." Im gleichen Atemzug gibt er widersprüchliche Auskünfte über sich selbst, nennt sich einen "Gemütsalbino", dem ein guter Kaffee wichtiger sei als der Zustand der Welt, und nimmt doch leidenschaftlich Anteil an ihr: Er sei immer auf Reisen, behauptet er, auch wenn er gerade in Berlin in seiner stillen Wohnung mit der schweigsamen Frau sitzt. Weil sie so gut wie keine Spuren hinterlässt und ihm das besonders an ihr gefällt, nennt er sie zärtlich "Lüftchen". Allen Helden in Matthias Zschokkes Geschichten (auch in den vermeintlich autobiographischen) geht es so, dass ein langweiliger, biederer Ort sie herausfordert. Deshalb gibt es in seinem skurrilen Reisebuch auch ein provokantes Kapitel, das "Kindheit" heißt. Darin malt sich der einsame "Neue Nachbar" die Urheberin der monotonen Cellotöne jenseits der Wand in wilden, erotischen Phantasien aus, und der Stadtwanderer Maurice betritt, mit dem Gewicht der ganzen Welt in den Armen, die Boulevards wie fremde, stickige Wohnzimmer.
Zu Beginn des neuen Romans trifft seinen Erzähler ein besonderer Schicksalsschlag: Die Frau, mit der er lebte - die eigentlich nicht seine war, wie er betont, denn sie war einmal anderweitig verheiratet -, hat sich das Leben genommen, still und unauffällig. Und er flüchtet aus der Wohnung, um jenes Harenberg zu suchen, von dem sie immer geschwärmt hat. Spätestens hier fühlt sich der Leser an einen der spröde erzählten Kaurismäki-Filme erinnert: Auch unser verstörter Erzähler ist ein "Mann ohne Vergangenheit", denn wie der finnische Regisseur zeigt Zschokke seine Figuren in ihrer existentiellen Nacktheit. Sie sind aus allen Bindungen und sozialen Netzen gefallen und werden damit sichtbar in ihrem schieren Sein, wirken aber gleichzeitig wie Solitäre, ja wie auf die Erde gefallene Engel. Zschokke ist, wie Kaurismäki, ein verschämter Romantiker, der in konzentriert poetischen, aber sparsam instrumentierten Bildern erzählt. So schildert er mit rauher Zärtlichkeit das Umherirren seines Helden in einem verfallenen Industriegebiet, bis er von einem freundlichen, aber rigorosen Zuhälter zur nahen Bar der Prostituierten Rosaura bugsiert wird, die dort "in privatem Ambiente" empfängt und belegte Brote, "unverfälschten Alkohol" und "viel dünne, weiße Haut" bietet.
Robert Walser, ein literarischer Ziehvater des 1954 in Bern geborenen Autors, charakterisiert die Hauptfigur seines Romans "Der Räuber" so: "Er kennt natürlich das sogenannte Leben, aber weil er es lieben will und wirklich liebt, kann es kommen, dass er es missversteht und dann wie ein Unkundiger aussieht." Auch Zschokkes Erzähler, 56 Jahre alt, ist solch ein Räuber, süchtig nach Zuneigung und Zuhörern, der mit genießerischer Wut über die Verlogenheit der Gesellschaft und ihre ignorante Gier herzieht und doch trotzig seinen kindlichen Glauben an wahre Empfindungen und einen unzerstörbaren Kern der Wörter bekennt, die ihm ständig im Mund zu zerfallen scheinen. Auch wenn ihm diese Sehnsucht frivol erscheint - denn selbst die Treffen und Gespräche mit seinem einzigen Freund (den wir aus Zschokkes gewagtem und sehr privatem Mail-Roman "An Nils" [sic! Recte: "Lieber Niels"] kennen) werden von Missverständnissen und Notlügen bestimmt.
Doch Rosaura vollbringt fast ohne Worte in ihrer kümmerlichen Bar ein Wunder: Weil sie den Besucher ständig verwechselt und von einem Tag zum nächsten scheinbar vergessen hat, fühlt er sich hier heimisch und probiert die Identitäten an wie neue Kleider. Auch seine erotischen Wünsche erfüllt Rosaura wortlos, und es zeigt die hohe Erzählkunst des Autors, dass gerade diese Szenen zu den zartesten des Romans gehören. So findet er in Rosaura die Liebe wieder an einem Ort, an dem er nur schlafen und nie wieder aufwachen wollte. Ungläubig staunend steht er neben ihr hinter der Bar, "in seinem dreiteiligen Anzug mit den zu langen Hosenbeinen", den ihm in Berlin ein anatolischer Änderungsschneider genäht hat und in dem er aussieht wie ein türkischer Politiker der fünfziger Jahre.
"Frankfurter Allgemeine Zeitung", 18.12.2o12
Ein Robert Walser unserer Zeit: Matthias Zschokke und sein Roman „Der Mann mit den zwei Augen“.
Von Jörg Magenau
Warum ist das Interessante eigentlich interessanter als das Langweilige? Ist denn Langweiliges nicht auch interessant? Matthias Zschokke stellt gerne vertrackte Fragen. In seinem neuen Roman mit dem seltsamen Titel „Der Mann mit den zwei Augen“ geht es um einen Gerichtsreporter, der die alltäglichen Fälle den spektakulären vorzieht. Das Spektakuläre „war ihm zu offensichtlich. Das Normale kam ihm auf eine viel spannendere Art kompliziert und interessant vor.“ Daraus ergibt sich, dass er mit seinen Reportagen nicht allzu erfolgreich ist. Denn die Welt bevorzugt nun einmal das Spektakuläre. Einer, der gegenüber Leuten, die interessant sein wollen, rasch die Geduld verliert und der sich selbst für langweilig hält, ist in ihren Augen eben nur: langweilig.
Matthias Zschokke ähnelt als Schriftsteller seinem „Mann mit den zwei Augen“. 1954 in Bern geboren, lebt er seit 1980 in Berlin, hat seither zahlreiche Romane, Erzählungen, Theaterstücke geschrieben und auch diverse Preise erhalten, und doch nie die große Aufmerksamkeit bekommen, die er literarisch verdient hätte. Das liegt daran, dass er – wie alle seine Helden – Nebensächlichkeiten den Vorzug gibt, dass er die leiseren Töne, das Abseitige und Einzelgängerische liebt und sich bescheiden im Hintergrund hält. Er ist ein Robert Walser unserer Zeit, einer, der sich klein macht, um sich unter den Zumutungen seiner Mitmenschen wegzuducken. In Kafkas Gregor Samsa, der sich mit einem Chitinpanzer wappnet, erkennt er einen Artverwandten. Dass ihn die selbstgewählte Rolle eines Mannes, der gern übersehen wird, auch ärgert, ließ er zuletzt in den fulminanten, an einen Freund gemailten Lebensmitschriften „Lieber Niels“ erkennen. Die Wut auf den Literaturbetrieb und alles Massenkulturhafte stand ihm gut. Sie grundiert nun auch den neuen Roman, der viel weniger freundlich ist als von Zschokke gewohnt.
Der Rückzug ins Schweigen und in die Einsamkeit, den dieser ZschokkeHeld angetreten hat, wird oft durchbrochen von langen, tiradenhaften Ausfälligkeiten: dem grotesk verschwurbelten Brief an eine Amtsrichterin, in dem er sich über steigende Mieten beklagt, einer wahnwitzig geschraubten Begrüßungsrede an einen neuen Nachbarn oder den sprachphilosophischen Ergüssen am Frühstückstisch, für die sich die Frau, die ihm da gegenübersitzt, nicht interessiert. Sie spricht lieber über ihren Nagellack.
Tatsächlich gibt es in diesem Roman sogar eine Handlung: Der Mann ist in die Kleinstadt Harenberg gezogen, um dort nach dem überraschenden Tod der Frau, mit der er zusammenwohnte, Erholung zu suchen. In seinen Erinnerungen entdeckt er, dass dieses rücksichtsvoll-distanzierte Zusammenleben vielleicht so etwas wie Liebe war. Ein verspäteter Liebesroman also, während der Mann in der Kleinstadt genauso einsam ist, wie er es in der Großstadt war.
Zschokke hat den Mann mit den zwei Augen wie ein Strichmännchen in allergrößter Allgemeinheit konzipiert. Wer ihm begegnet, vergisst ihn gleich wieder, so unauffällig sieht er aus. Die Wirtin, seine letzte Vertrauensperson, erkennt ihn selbst dann nicht wieder, nachdem sie auf sein Bitten hin mit ihm ins Bett gegangen ist. Die Geschichten von Katzen, Hunden, sinnlosen Reisen und quälenden Gästen, die der Mann erzählt, vergisst man aber nicht so leicht. Man könnte sagen: Der Roman handelt von Kommunikationsstörungen und Identitätsproblemen. Gespräche sind unmöglich, sie missraten regelmäßig zu absurden Monologen. Nähe ist kein Ziel, denn den Menschen ist besser aus dem Weg zu gehen. Nur auf Dinge und Tiere ist Verlass.
Sexualität erscheint folglich als pragmatischer, geschäftsmäßiger Akt, und zwar in den verschiedensten Varianten. Da wird Zschokke ziemlich derb und direkt. Das Geschlechtliche beschreibt er so, wie er auch Bewegungen im Straßenverkehr beschreibt: als äußerlichen Vorgang, dem er als bloßer Beobachter beiwohnt. Ähnlich kühl taucht auch die Erinnerung an eine Vergewaltigung durch einen alten Herrn auf, wie sie der Mann als Junge auf dem nächtlichen Nachhauseweg erlebte. Vielleicht hat es damit zu tun, dass das Sexuelle jeden Bezug zu den Gefühlen verloren hat und dass es schambehafteter ist, mit jemandem ins Gespräch kommen zu müssen, als die Geschlechtsteile aneinander zu reiben. Diese Gestörtheiten werden jedoch nicht psychologisiert oder auch nur kommentiert. Sie werden mit ungerührter Miene als Normalität zur Kenntnis genommen.
Man könnte diesen Roman deshalb auch als abgründiges Manifest gegen den Kapitalismus lesen, der nicht nur die Brötchen in Aufbackbatzen und überhaupt die Dinge in billige Waren verwandelt und damit vernichtet, sondern auch die Beziehungen zwischen den Menschen zerstört. Aber auch die gesellschaftskritische Schublade wäre zu klein für diesen Autor und ein Buch so voller Boshaftigkeit, Wut und Witz und der puren Lust am Erzählen. Zschokke macht aus Nebensächlichkeiten große Literatur und verwandelt das Langweilige in etwas Aufregendes. Das ist der entgegengesetzte Weg zu dem der vielen, den er in der Gesellschaft beobachtet und beklagt.
"Tagesspiegel", Berlin, 2.12.2o12

Poetische Fluchthilfe aus dem falschen Leben
Matthias Zschokke: "Der Mann mit den zwei Augen"
Von Michaela Schmitz
In dem Buch "Mann mit den zwei Augen" lässt der Autor Matthias Zschokke seine Figur ausgerechnet dort nach dem Leben suchen, wo es vermeintlich nicht stattfindet: Der Mann zieht, nachdem er Katze und Frau verloren hat, auf der Suche nach sich selbst nach Harenberg, einer fiktiven Metropole von Allgemeinplätzen.
Was, wenn einer ausgerechnet dort nach dem Leben sucht, wo es vermeintlich nicht stattfindet? In den Augenblicken größter Langeweile, im verpassten Moment, in der falschen Bewegung, beim Aneinander-Vorbeireden, in der völlig unpassenden Reaktion, im total verpatzten Liebesspiel.
Matthias Zschokke lässt seinen "Mann mit den zwei Augen" im gleichnamigen Roman genau dort danach suchen. Die richtige Frau hört der Mann im Kirchenchor gleich am falschen Gesang heraus. Beim Liebesspiel reiben sich die beiden leidenschaftslos aneinander wie Tiere ihr juckendes Fell am Baum. Über 30 Jahre lang leben sie, wie aus Versehen, in einer Wohnung. "Der Mann mit den zwei Augen" hält der Frau gerne lange philosophische Monologe. Die Frau antwortet mit Unverständnis und naiv-komischen Sprechblasen wie: "Sie plage nicht nur Wissensdurst, sondern Magenknurren und Lust auf Wurst". Eines Tages folgt die Frau der Katze in den Tod. Der Mann zieht auf der Suche nach sich selbst nach Harenberg, der fiktiven Metropole der Allgemeinplätze. Doch dort hält man ihn, wie immer, für einen anderen. Völlig ungerührt plant er daraufhin seinen Selbstmord. Doch statt sich zu erhängen, strandet er versehentlich hinter der Bar des Nachtklubs von Rosaura. So zumindest könnte die Geschichte enden, bemerkt der Erzähler direkt zum Leser gewandt.
Denn die Geschichte vom "Mann mit den zwei Augen" und der Frau ohne Eigenschaften meint keinen, aber trifft jeden. Die grob skizzierten, farblosen Darsteller sind stilisierte menschliche Schattenrisse ohne jede emotionale Tiefe. Ihr Leben ist so banal und beliebig wie universell.
"Wie ich rätselt bestimmt die halbe Welt von morgens bis abends an sich herum und stirbt, ohne etwas begriffen zu haben. (...) Alle bringen doch alles nur noch so schnell wie möglich hinter sich, in der Hoffnung, endlich an den Punkt zu gelangen, an dem für einmal etwas mit seinem Namen zusammenfällt, was man dann erleichtert mit seiner eigenen Gegenwart (...) ausfüllen möchte. Doch keiner kommt jemals beim Eigentlichen an."
Es ist, so scheint es, kein wahres Leben im falschen möglich. Denn das Leben erweist sich als Attrappe. Die Welt ist ein Simulationsmodell. Wie ferngesteuerte Textautomaten bewegen sich die Figuren in einer Pseudo-Realität und sondern pausenlos ausdruckslose Sprechblasensätze ab, die im toten Raum verpuffen. Ihr Denken ist so eng wie die künstlichen Räume, in denen sie herumstehen wie seelenlose Möbelstücke. Miteinander reden gleicht einem ritualisierten Missverstehen. Zusammen ist man einsamer als allein. Und "Liebe ist kälter als der Tod", möchte man mit Rainer Werner Fassbinders sprichwörtlich gewordenem Filmtitel schließen.
Hier irgendwo zwischen den Kunstfilmen Rainer Werner Fassbinders und den Lehrstücken Bertolt Brechts ist Matthias Zschokkes Parabel vom "Mann mit den zwei Augen" zu verorten. Wie der Film- und Bühnenklassiker setzt Zschokke substanziell Alltägliches in stilisierte Bilder von extremer Künstlichkeit um. Seine Figuren wirken, ähnlich den Darstellern in Fassbinders Filmen, "wie verschneit von innen". Die emotionale Kälte findet im völlig distanzierten formalisierten Sprechen ihren Ausdruck. Es ist ein Ausdruck ohne Leiden und ein Leiden ohne Geschmack. Der Mann und die Frau bleiben auch nach 30 Jahren beim Sie - sogar noch im fingierten Abschiedsbrief der Frau; einem im emotionsfreien Beamtendeutsch formulierten und in seiner unsentimentalen Förmlichkeit traurig-komischen Dokument vom Charme einer juristischen Stellungnahme. Der Tod ist eben genauso wenig authentisch wie das Leben. Ein Leben, das in Zschokkes Geschichte vom "Mann mit den zwei Augen" in eine scheinbar beliebige Aufeinanderfolge künstlich ausgeleuchteter Studioszenen zerfällt. Im Bühnenlicht und durch die Verfremdungseffekte werden die Sequenzen zum Modell eines falschen Lebens, das der Leser mit seinem eigenen vergleicht. Dessen Sehnsucht nach echtem Leben und wahrer Liebe wird doppelt enttäuscht. Fast zwangsläufig wächst daraus die Wunschfantasie nach einer neuen, besseren Realität: einer Utopie. Denn ohne Utopie, weiß Bardame Rosaura, ist der Mensch nicht mehr als ein Insekt:
"Wenn Sie sich heute Abend aufhängen, würden Sie sterben, (...) ohne gelebt zu haben, (...) und ob sie da sind oder nicht, das hat keinen Einfluss auf den Fortlauf der Dinge. (...) Bei Tieren nimmt man das hin, bei sich selbst weniger gern. (...) Insekten zum Beispiel (...) kommen auf die Welt, leben ihr Insektenleben, werden zertreten aus Versehen und sind weg. (...) So ein Insektenleben fristen Sie und ich. (...) Man setzt einen Schritt vor den anderen, und eines Tages fällt man um und ist tot. Ein Drama ergibt das natürlich nicht."
Nein, ein Drama ergibt das wohl nicht. Aber ein melodramatisches Lehrstück vielleicht doch. Denn wer will schon als lästiges Insekt versehentlich zertreten werden? Für den Leser beginnt die Geschichte nämlich erst dann, wenn der Roman zu Ende ist. Die tote Erzählung soll im Kopf der Leser lebendig und im Bezug auf seine eigene Wirklichkeit weiterfantasiert werden. Denn vielleicht gibt es ja doch ein wahres Leben hinter dem falschen?
Hinter Matthias Zschokkes stilisierten Angstbildern vom falschen Leben wütet jedenfalls der Zorn über die schale Wirklichkeit, hinter der Beziehungs- und Kommunikationsunfähigkeit seiner marionettenhaft ferngesteuerten Figuren steht der unbedingte Glaube an die Liebes- und Mitteilungsbedürftigkeit des Einzelnen. In seiner in Künstlichkeit erstarrten negativen Utopie fordert Zschokke den Leser dazu auf, selbst das positive Gegenbild einer besseren Realität zu entwickeln. In den puppenhaften Darstellern, den ungerührten Dialogen und der gekünstelten Inszenierung verfremdet Zschokke die Welt zu einer Kunstwelt, bis sich die Wirklichkeit als Projektion erweist. Gerade das Unrealistische soll die Leser paradoxerweise näher zu ihrer eigenen Realität und darüber hinaus zur Utopie einer besseren Wirklichkeit führen. Denn die Veränderung soll schließlich nicht im Roman stattfinden, sondern im Leben. Aber ist das Literatur? Nein, wenn man darunter die poetische Fluchthilfe aus dem falschen Leben in eine schöne bessere Kunstwelt erwartet. Ja, wenn man Literatur im Sinne der Konzeptkunst als Anstoß eines künstlerischen Prozesses versteht, der erst im Kopf des Lesers stattfindet. Matthias Zschokkes "Mann mit den zwei Augen" ist Konzeptliteratur. Die Idee ist gut, ausgerechnet dort nach dem Leben zu suchen, wo es vermeintlich nicht stattfindet. Doch leider liest sich der Text in weiten Teilen so sperrig, dass der Prozess gleich im ersten Befremden darüber steckenzubleiben droht.
"Deutschlandfunk", Köln, 3o.1o.2o12

Der Mann mit den zwei Augen
Matthias Zschokke
Matthias Zschokke erzählt in seinem neuen Roman von einem gewöhnlichen Mann, der ins Alter gekommen ist und soeben seine Frau verlor. Sie nahm sich das Leben. Er bleibt in der Welt zurück, und geht ungerührt seiner einsamen Wege. Von einem andern Menschen können wir ohnehin nichts wissen, wo wir uns selbst kaum kennen. Zschokkes Roman schwankt gefährlich zwischen absurdem Witz und bedrückender Entfremdung. Er ist einerseits das ausgebuffte Porträt eines Jedermann – zugleich erzählt es vom Menschen als einem im Kern einsamen, geradezu heroisch misanthropischen Wesen.
Beat Mazenauer
*
Ein Überdruss an Glück
Von Beat Mazenauer
«Der Mann mit den zwei Augen», allgemeiner und nichtssagender lässt sich ein Protagonist nicht charakterisieren. Doch es gibt über ihn tatsächlich nichts Auffälliges zu berichten. Selbst der Friseur hat darauf zu achten, denn «mein Kopf soll Ausgeglichenheit ausstrahlen, Vertrauenswürdigkeit, sodass niemand, der mich sieht, anfängt, sich Gedanken zu machen über mich oder darüber, wie es in mir drin ausschaut, am allerwenigsten ich selbst». Letzteres ist besonders zu bedenken.
Dem Mann ist die Frau weggestorben, mit der er viele Jahre zusammen lebte. Trotzdem wüsste er von ihr kaum Nennenswertes zu berichten. Ja sie hatten es die ganze Zeit sogar versäumt, sich das Du anzutragen. Sie las, er nicht, dazwischen lag eine Kluft. Er schrieb Gerichtsreportagen, sie hatte keine Bildung, worüber sollten sie da reden. So blieben sich der Mann mit den zwei Augen und die Frau all die Jahre in vertrauter Innigkeit fremd. Nun ist sie tot – er aber spürt «geradezu einen Widerwillen gegen das Aussergewöhnliche“. Deshalb wahrt er um jeden Preis die Contenance und entschliesst sich, aus der Stadt zu flüchten, in einen Ort namens Harenberg. Hier hofft er, «als Überflüssiger» nicht gebraucht zu werden. In der Kneipwirtin Rosaura findet er ein wunderbares Medium, das ihn täglich begrüsst und dabei nie wiedererkennt. Bei ihr ist der Mann mit den zwei Augen in der Unscheinbarkeit angekommen. Darin besteht sein Abenteuer, glaubt er, denn warum sollte es spannender sein, etwas zu verbergen, «als nichts zu verbergen»? Trotzdem kann der Mann keinesfalls unglücklich genannt werden.
Zschokkes Roman erzählt von einem Menschen, dessen unendliche Trägheit auf den Roman selbst überspringt. Nichts scheint darin zu passieren, und dennoch wirkt diese Prosa hellwach und stets auf dem Sprung – wohin?
Die titelgebende Charakterisierung variiert Zschokke mit einem Diktum aus dem Koran, wonach der Mensch zwei Ohren habe zu hören, doch nur eine Zunge zu sprechen. Und, liesse sich ergänzen: Er hat zwei Augen, um wahrzunehmen. Dementsprechend verhält sich sein Protagonist weitgehend passiv. Er ortet, lotet aus und zieht aus nichts keine Schlüsse. Gerade darin ist er heroisch: Repräsentant einer melancholischen Conditio humana, die Werten wie Liebe, Vertrauen, Zusammenleben mit grösstem Misstrauen begegnet, weil sie nichts zu bedeuten haben. Auch der Beischlaf gerät ihm zur mechanischen Praxis.
Das klingt ausgesprochen pessimistisch, ja gar sarkastisch. Matthias Zschokke zeigt sich hier von einer finstern Seite wie seit langem nicht mehr. Der Lebensüberdruss des Mannes mit den zwei Augen, für den dieser selbst keine Erklärung anzugeben wüsste, erinnert an die «Piraten» aus dem gleichnamigen Roman von 1991, die ihre wilde Entschlossenheit abgelegt haben und bloss noch im Wind dahin dümpeln. Ihre Verdüsterung klingt nach.
Der Mann mit den zwei Augen zeichnet sich aus durch seinen untrüglichen Blick für den täglichen Wahnsinn. Aus seiner Optik erscheint das Gezerre und Gerenne bloss noch lächerlich. «Wir wissen schliesslich alle das Gleiche, erleben das Gleiche, sehen das Gleiche – was soll da einer noch viele Worte machen?», lässt er ausrichten. Er bringt Sachverhalte mit verfänglich einfachen Worten auf jenen Punkt, an dem sich der Überdruss kristallisiert. Freilich bedeutet das nicht, dass diese Prosa nicht auch Witz verriete, und nicht zum Lachen reizte. Immer wieder stösst Zschokke das Tor zu tragikomischen Szenen und grandiosen Anekdoten auf. Ab und an kann sich der Mann Seitenhiebe nicht verkneifen, die unmerklich den gerührten Autor selbst verraten. Meist aber wahrt der Mann die Nonchalance des Ungerührten. Der komische, langweilige Tapir im Zoo wird sein Wappentier.
«Ich lebe auswendig», sagt der Mann einmal, der Körper wiederhole bloss noch, was er schon kann. In diesem Bekenntnis liegt seine Wahrhaftigkeit. Unter diesen Umständen gehört einiges dazu, „sich selbst ein Leben lang aushalten» zu können. «Jede Kunst braucht einen Funken Verwegenheit», die auch die Möglichkeit des Scheiterns mit einschliesst, führt der Mann einmal ins Feld. So wenig der Satz auf ihn selbst zutrifft, so sehr gilt er für Zschokkes Prosa. Ihr träge mäanderndes Dahinfliessen, das sich hin und wieder auch um formale Perfektion foutiert (wem gehört die Erzählerstimme?), erzeugt einen Sog, von dem sich die Lektüre sachte treiben lässt. Die Illusionslosigkeit wirkt ebenso radikal wie beruhigend.
«Wir leben ein schlechteres Leben aus Angst, ums bessere könnte man uns beneiden, das bessere könnte uns gestohlen werden». Deshalb wählt der Mann mit den zwei Augen ein gutes Leben ohne diese Angst. Ist das besser? Es bleibt dem Leser überlassen, die eigenen Schlüsse zu ziehen, Matthias Zschokkes Protagonist gibt keine Antworten. So klingt das Buch prosaisch in der Harenberger Kneipe aus, mit einer Reminiszenz an Büchners «Lenz»-Novelle: «Und so lebten sie hin...» – ganz ohne Not, denn das Leben ist im Kern so oder so ein einziges Dahin.
"viceversa literatur.ch", 21.1o.2o12


Interview mit Matthias Zschokke
»Eigentlich ist es für mich längst an der Zeit aufzuhören.«
Belletristik-Couch: Viele Roman-Autoren müssen sich fragen lassen, wie viel von ihnen selbst in der Hauptfigur steckt. Wie sieht das bei Ihnen aus Herr Zschokke, welche Farben tragen Sie? Sind Sie auch durch und durch in »Sand« gekleidet?
Matthias Zschokke: Ich trage meistens grün.
Belletristik-Couch: Wenngleich Ihr Protagonist mit den zwei Augen nach außen hin langweilig, farblos erscheint, ist es doch er, der sich von der lauten, leuchtenden Masse abhebt – positiv abhebt. Der vielschichtiger ist, denkender, beobachtender und weniger oberflächlich, als die uniformierte Masse. Warum hat ausgerechnet Ihr Mann keinen Namen? Einen passenden hätten Sie bestimmt leicht gefunden und zudem viel Schreibfläche gespart, weil Sie nicht hätten umständlich umschreiben müssen.
Matthias Zschokke: Ich habe ihn namenlos gelassen. Das lässt ihm Luft zu sein, was und wer er sein will.
Belletristik-Couch: Ist es gerade en vogue, seine Protagonisten ohne Namen zu lassen? Sie sind nicht der einzige, der aktuell auf die Namensgebung verzichtet.
Matthias Zschokke: Was en vogue ist, weiss ich nicht. Bislang hatte ich nie das Glück, es zu sein. Falls es diesmal anders sein sollte, würde es mich freuen. Schliesslich bemühe ich mich seit dreissig Jahren, etwas en vogue zu produzieren (stelle mir märchenhafte Auflagenzahlen dazu vor).
Belletristik-Couch: Auch die Frau, mit der der Mann mit den zwei Augen sich dreißig Jahre lang eine Wohnung teil, ist namenlos. Mehr noch, dass Paar siezt sich. War Ihnen das ein Anliegen, in dieser lauten, schnellen Zeit eine ganz leise Liebesgeschichte zu verfassen? Denn das ist sie ja irgendwie. Wenngleich auch versteckt. ?
Matthias Zschokke: Das Siezen hat sich wie die Namenlosigkeit beim Schreiben ergeben und als hilfreich erwiesen. Es erklärt sich wie von selbst im Text, wirkt also nicht aufgezwungen, und bietet dann eine eigenartige Behutsamkeit im Umgang mit dem Stoff, den Figuren, den Geschichten. Vielleicht kennen Sie das auch: Leute, die Sie jahrelang gesiezt haben und nun plötzlich duzen sollen das ist schwierig; alles sperrt sich in Ihnen dagegen.
Belletristik-Couch: »Ich sinnlose vor mich hin …und das mit Begeisterung!«, gab der Satiriker Gerhard Polt in einem Interview im Magazin der Süddeutschen Zeitung bekannt. Polt spricht darin über die Langeweile, wie sehr er die schätze und ist sich sicher, dass es vielleicht nicht nur Wirtschaftskriege gibt, sondern auch »Kriege aus Langeweile«. Ihr Protagonist bekriegt nicht seine Umwelt. Er lebt bescheiden, isoliert, verhält sich nur der Frau gegenüber nicht immer sehr charmant. Wie passt es da zusammen, dass so ein Herr Biedermann Gerichtsreporter ist? Erfreut er sich insgeheim am Schicksal der anderen, am aufgeregten Leben mit Schuld und Sühne? Oder stellt er beglückt fest, wie ruhig es in seiner eigenen Welt zugeht?
Matthias Zschokke: Die Zeitungen leben davon, dass sie uns von Dingen berichten, die die Norm sprengen. Mein Protagonist kann dank dieser schlecht bezahlten Arbeit seine Miete bezahlen.
Belletristik-Couch: Was trifft auf Sie zu: Nietzschefimmel oder Hegelknall? Hammer oder Bohrer? Oder gar beides?
Matthias Zschokke: Weder Nietzsche noch Hegel. Das Denken dieser beiden erledige ich selbst, eher bohrend als hämmernd.
Belletristik-Couch: Geboren sind Sie in Bern. Leben seit Jahrzehnten in Berlin. Zuweilen werden in Ihrem Roman Ortschaften benannt, nur die Hauptstadt bleibt Hauptstadt. Ist es Bern oder ist es Berlin – oder beides nicht?
Matthias Zschokke: Habe ich die Hauptstadt nie namentlich erwähnt? Dann war`s wohl auch nicht nötig. Es geht schliesslich nicht um Bern oder Berlin in dem Buch, sondern wenn überhaupt um »Bern« oder »Berlin«. Bevor ich nun mühsam die Anführungszeichen erklären muss, lasse ich`s lieber bei der Hauptstadt bewenden.
Belletristik-Couch: Die Kuss-Szene, in der der Mann mit den zwei Augen, ich sage mal der Einfachheit halber, seine Frau küsst, erinnert an die Einspielung in der James L. Brooks-Filmkomödie »Besser geht`s nicht«. Jack Nicholson drückt dabei seine Lippen fest und unbewegt auf die seiner Filmpartnerin Helen Hunt. Gefühllos offensichtlich, kalt und hölzern. Ihrem Protagonisten nicht ganz unähnlich, ein »Empfindungsalbino« sei er. Warum gibt es in Ihrem Roman keine warmherzige, romantische Liebe? Warum sind sexuelle Erfahrungen, schon im Jugendalter des Mannes mit den zwei Augen, mit Schmerz verbunden?
Matthias Zschokke: Küssen und lieben ist weniger einfach, als im Feierabend-TV und in erfolgreichen Romanen immer vorgegaukelt wird. Wenn`s gelingt, ist es schön und wert, aufgeschrieben zu werden. Manchmal gelingt es nicht, das ist dann auch schön und wert aufgeschrieben zu werden.
Belletristik-Couch: Sie verpassen dem Mann mit den zwei Augen ein biederes Äußeres. Er wirkt korrekt und unauffällig. Warum also fälscht er Bustickets für seine Frau? Fühlt er ihr sich doch verbundener, als Sie es offensichtlich scheinen lassen? Oder ist er gar ein Rebell im Leisen?
Matthias Zschokke: Mag sein, es liegt bei meinen Protagonisten nicht so offen auf der Hand, aber was die beiden miteinander verbindet, ist meiner Meinung nach eindeutig eine innige und belastbare Liebe. Bustickets fälschen spart Geld.
Belletristik-Couch: Sie spielen gerne an: Greifen Themen auf, verlassen sie wieder und kehren nicht dahin zurück. Es geht um Arbeit: »Gibt es nicht sogar ein geflügeltes Wort, das die befreiende Wirkung von Arbeit umflattert? Eins aus der Bibel? Oder aus der Kriegsphilosophie?« Testen Sie das Wissen Ihrer Leserschaft?
Matthias Zschokke: Literatur, in der alles auserzählt wird, langweilt mich oft. Ich mag, wenn sie mich mitdenken lässt, wenn die Sätze mehrere Ebenen enthalten, wenn ich als Leser selbst entscheiden darf, ob ich etwas lustig finde oder traurig, wenn eine Tasse nicht festgeschrieben eine weiße von Ikea ist, sondern wenn ich sie mir aus Meissner Porzellan oder Bakelit oder heiß, direkt von einer italienischen Kaffeemaschine heruntergeholt, vorstellen kann. Ich mag, wenn das Aufgeschriebene mehr enthält als das, was da steht.
Belletristik-Couch: Auch spielen Sie mit Klischees (»Wer wenig Geld verdient ist faul«), sprechen den Koran an, erzürnen sich über Mietwucher, prangern Kindermissbrauch im jesuitischen Internat an: Ihr sandfarbener Herr Namenlos ist vielseitig interessiert, befasst sich mit dem römischen Kaiser Nero und dem römischen Historiker und Senator Tacitus, mit Wahrheit und Lüge, mit der Routine des Lebens, mit sich selbst. An Kritik mangelt es dem Mann mit den zwei Augen nicht. Letztendlich stellt er fest: »Unser Problem ist, keins zu haben.« Ist Ihr Roman ein Appell an all jene Nörgler, Schimpfer und Alleshasser, das Leben mal etwas gelassener zu sehen? Runter zu kommen von dem hohen Ross, seinen eigenen Weg mehr zu verfolgen, als nur darüber zu tratschen, was die Nachbarn machen, gefallen zu müssen?
Matthias Zschokke: Was uns der Autor mit dem Ganzen sagen wollte? Keine Ahnung. Wüsste ich`s in weniger Worten zu sagen oder könnte es gar zusammenfassen, hätte ich`s in weniger Worten gesagt oder gleich zusammengefasst.
Belletristik-Couch: Nach unter anderem »Der dicke Dichter« (2005) und »Lieber Niels« (2011) ist Ihnen mit »Der Mann mit den zwei Augen« wieder ein großartiger Roman gelungen. Wie geht es weiter, Herr Zschokke?
Matthias Zschokke: Sie haben recht: Eigentlich ist es für mich längst an der Zeit aufzuhören. So wie Rossini, der das Komponieren irgendwann an den Nagel gehängt und sich aufs »Tournedos à la Rossini«-Zubereiten konzentriert hat. Nur hatte der bis dahin ein paar Operndauerbrenner vorgelegt. Das kann ich von mir leider noch nicht behaupten.
Britta Höhne in "Belletristik-Couch.de". Norden, Oktober 2o12

Alles Theater, alles Spiel
Carsten Hueck
Ein Mann verliert Frau und Katze, hört auf zu arbeiten, kündigt die Wohnung, verreist und erinnert sich an sein Leben. Matthias Zschokkes kauziger Held ist ein selbstbewusster Gesellschaftskritiker, dessen unbestechlicher Blick den Alltag seziert.
Das Gewöhnliche ungewöhnlich erscheinen zu lassen, ist eine Spezialität des gebürtigen Schweizers und seit über 30 Jahren in Berlin lebenden Autors Matthias Zschokke. Das beginnt schon bei den Titeln. Seine Romane benennt er gerne schlicht nach ihren Helden. Sie heißen "Max" oder "Maurice mit Huhn", "Der dicke Dichter", "Prinz Hans" und - so das jüngste Werk - "Der Mann mit den zwei Augen".
Kommen diese Titel auch verspielt daher, so werfen die Figuren im Roman nicht selten existenzielle Fragen auf. Zschokke erzählt von der Selbstverständlichkeit deformierten Lebens in der modernen Welt. Seine Protagonisten sind Artisten des Daseins, Wahrnehmungskünstler, hochsensible, eigenwillige Zeitgenossen, Flaneure im Kosmos allgemeinen Wahnsinns. Heiter erzählt Zschokke von ihnen, leicht und souverän. Dort, wo Thomas Bernhard in endlosen literarischen Umdrehungen sich erhitzt, schwebt bei Zschokke, der nicht minder misanthropisch, voll Wut und Ekel über Absurdität und Zumutungen des Lebens sich auslassen kann, letztlich immer ein Lächeln über den fein gearbeiteten Texten, widerspenstig und melancholisch zugleich, voller Staunen über das, was sich ihm bietet. Es signalisiert lustvoll: alles Theater, alles ein verzweifeltes Spiel.
Der Mann mit den zwei Augen, von dem erst am Ende des neuen Romans angedeutet wird, dass er Philibert heißen könnte, ist ein 56-jähriger Gerichtsreporter "in der Hauptstadt". Er hört auf zu arbeiten, als ihm von einem Tag auf den anderen Katze und Frau wegsterben. Die Katze aus Altersschwäche, die Frau aus Müdigkeit.
Der Mann kündigt die Wohnung und reist, nur wenige Habseligkeiten im Koffer, in eine ihm bislang unbekannte Kleinstadt. Mietet sich dort in einer Pension ein und erinnert sich des Lebens, das er bis bislang geführt hat. Man erfährt vom Zusammenleben mit der verstorbenen Frau, seinen Eigenarten, darunter auch von der durch gymnasialen Griechisch-Unterricht angeregten Neugier, in "sodomitische Praktiken" eingeführt zu werden. Die Gastwirtin Rosaura vermittelt ihm einen jungen Mann, "der auf dem Gebiet des Hinterladens erfahren ist". Doch wahre Freude vermag der Mann mit den zwei Augen nicht zu fühlen. Nach knapp 250 Seiten, sein Geld ist mittlerweile aufgebraucht, verabschiedet er sich mit der Ankündigung, sich erhängen zu wollen.
Zschokkes "Mann mit den zwei Augen" ist eine kauzige Figur, ein selbstbewusster "Idiosynkratiker", ein Gesellschaftskritiker, dessen unbestechlicher Blick sich durch enorme Tiefenschärfe auszeichnet. Seine Beobachtungen, Gefühlszustände und Ticks sind präzise, leicht, ironisch, unterhaltsam und mit großer Sprachlust geschildert. Der Autor lässt ihn seinen Alltag sezieren, hebt diesen so aus seiner scheinbaren Banalität und entwickelt aus ihm neue Geschichten. Zschokke beherrscht als Autor das Magische: Aus nichts macht er etwas und indem er das Leben in seiner Bizarrerie beschreibt, erhält es Wert und Gewicht, Anmut und Glanz.
"Deutschlandradio Kultur", Berlin, 19.9.2012

Mann mit Katze
Matthias Zschokkes Roman «Der Mann mit den zwei Augen»
Samuel Moser
Eines Tages taucht er auf in der kleinen Stadt, der Mann «mit den zwei Augen». Er betritt ein Lokal gleich hinter dem Bahnhof, Bar oder Nachtschuppen, düster jedenfalls und etwas heruntergekommen wie er selber mit seinem Koffer und dem sandfarbenen Regenmantel. Ein Schicksal hat er nicht, er ist bloss von ihm geschlagen: Frau, Erbschaft, Beruf, Freund, Wohnung, Katze – die Reihenfolge könnte auch anders sein –, alles hat er verloren in der grossen Stadt, aus der er gekommen ist. Jetzt ist er da, in Harenberg, nimmt sich ein Zimmer in einer schäbigen Pension. Ein Heimkehrer, sagen die Harenberger, ein Gescheiterter, der zu hoch hinauswollte. Wir kennen dich doch! Der Mann glaubt an eine Verwechslung. Er ist zwar kein Sonderling – aber das auf eine sonderbare Weise. Das ist arrogant. Er solle nicht so tun, sagt die Wirtin Rosaura: «Sie haben zwei Augen, eine Nase, einen Mund – so etwas vergesse ich nicht so rasch.»
Das Glücksversprechen
Recht hat sie, so wie die Harenberger immer recht haben, verkörpern sie doch das Leben, dem man nicht entkommt. Wobei gerade die Harenberger vom Entkommen träumen und nicht der Mann, dem das Leben abhandengekommen ist. Es scheint – der Eindruck wird immer stärker –, er sei mit seinen zwei Augen doch etwas anderes als einfach ein Mann mit zwei Augen. Weniger zwar als ein Mann mit einem oder gar keinem Auge, denn das sind ausserordentliche Wesen mit gewaltigen Schicksalen. Aber das, was Zschokkes Mann weniger hat, verwandelt sich unter der Feder des Dichters zu dem, was ihn auszeichnet. In seine zwei Augen zaubert Zschokke – manchmal heller, manchmal matter – ein Versprechen: das Glücksversprechen des Gewöhnlichen.
Zschokkes Sätze sind gnadenlos freundlich. Und weil sein Mann nur aus diesen Sätzen besteht, ist auch er von einer geradezu zärtlichen Aggressivität. Niederlage um Niederlage reiht er aneinander – als wäre es eine Perlenkette. Nichts beschönigt Zschokke dabei, nichts deutet er um. Er deutet überhaupt nichts an dem Mann mit seinen Problemen, die allesamt die bekannten Probleme unserer Zeit sind. Hie und da empfindet er Glück – beim Bügeln beispielsweise. Dann wieder fühlt er sich wie «vor die Wand gefahren». Meist aber schaut er bloss «so» mit seinen zwei Augen. Vorurteilslosigkeit ist seine Kunst, Fassungslosigkeit seine Lebensenergie. Er ist ein Komplizierter, der immer in das hineingerät, was er vermeiden möchte. «Empfindungsalbino» nennt er sich, welch ein Wort: hochgradig empfindlich gegen Empfindungen! Das ist umwerfend komisch – nur nicht für ihn selber, und weil es für ihn selber nicht komisch ist, ist es dies auch für den Leser nicht.
«Der Mann mit den zwei Augen» ist ein abgründig heiterer Liebesroman. Bevor der Mann nach Harenberg kam, lebte er in der grossen Stadt eine Ewigkeit mit einer Frau zusammen. Nicht mit «seiner» Frau, mit «der» Frau. Ein Ausdruck der Genauigkeit ihrer Beziehung. Das Paar gleicht sich darin, dass beide sich an ihre Ungleichheit gewöhnt haben. Die Liebe schwelt in ihrem Abstand zueinander. Mit «Sie Hauch, Sie Lüftchen, Sie leichte Brise» redet der Mann sie an. Sie ist eine Meisterin des Schweigens. Während er sich in seinen Zweifeln an allem immer neu zu grandiosen «Ansprachen» emporschwingt; zu einem Sprachfuchtler wird vor dem, was mit Worten schon gar nicht zu fassen ist: dem «wahren» Leben. Aber seine Reden sind die Jagdtrophäen seiner «kläglichen Existenz», die er der Frau stolz zu Füssen legt – welche sie dann freundlich da liegen lässt.
Der Roman und die Liebesgeschichte beginnen da, wo sie zu Ende sind: mit einem Telefonanruf des Mannes in die Klinik, in der die Frau sich befindet. «Io dormo, io dormo», antwortet sie, als wäre sie eine Italienerin. Als könnte man so etwas überhaupt sagen. Dann bekommt sie einen Hustenanfall, und der Mann verabschiedet sich. Am Abend desselben Tages stirbt sie, trinkt das Morphin, das der Mann doch für einen gemeinsamen Tod reserviert hatte. Nie hat er ihr in all den Jahren etwas Wichtiges zu sagen zu haben geglaubt. Jetzt kommt er zu spät. Ihre Katze sei gestorben, wollte er der Frau mitteilen – und beginnt gleich von der Katze zu reden. Nicht dass ihr Tod ihm wichtiger ist. Von der Katze zu reden, ist bloss seine Möglichkeit, von der Frau zu reden. In einer wunderbaren Fensterszene wird solche Indirektheit zum Glücksmoment. Sie liest sich wie eine Kontrafaktur der berühmten Werther-Szene. Hier wie dort tobt draussen ein Gewitter. Aber während Goethes Werther bei Lottes Losungswort «Klopstock» weinend im «Strom der Empfindung» versinkt, taucht Zschokkes Mann daraus auf. «So, dann wollen wir wohl mal wieder», sagt er, als das Gewitter vorüber ist, und wendet sich der Frau zu, die weiter hinausschaut: Und «wenn er sie so dastehen sah, klopfte ihm manchmal das Herz hinter den Ohren und in den Fersen vor Glück».
Der Seitenwechsel
Aus Zschokkes Erstling «Max» kennen wir die Schwierigkeiten, eine Figur, die man in einem Buch hervorgezaubert hat, auch wieder verschwinden zu lassen. Acht Möglichkeiten spielte er damals durch. Jetzt ist es bloss noch eine. Die Geschichte des Mannes, so meldet sich der Autor, hätte sich so abspielen können, wie er sie erzählt habe: als ein langsames Vertaumeln an Rosauras Tresen. Und dann der Strick. Das Morphin hat ja die Frau aufgebraucht. Natürlich hätte der Mann jemanden bezahlt dafür, seine Leiche abzuhängen, schliesslich ist das kein schöner Anblick. Rosaura leiht ihm dafür auch Geld, aber zuerst einmal redet sie ihm ins Gewissen: Sie sind ein Überflüssiger, also seien Sie es «von ganzem Herzen», und behalten Sie es für sich! Es überzeugt den Mann wenig. Aber da sich auch für Geld keiner zum letzten Dienst finden lässt, wechselt er einstweilen die Seite, stellt sich zu Rosaura hinter den Tresen und macht sich nützlich. «Und so lebten sie hin» ist der letzte Satz des Romans – nein, der vorletzte.
"Neue Zürcher Zeitung", 15.9.2o12

Wo selbst Bleistiftspitzen zum sprachlichen Genuss wird
Matthias Zschokke erzählt in seinem Roman mit grosser Sprachmacht von den kleinen Dingen
Anna Kardos
Seine Figuren haben veritable Manien, wie «Der Mann mit den zwei Augen» zeigt. Trotzdem muss man sie einfach mögen.
Seine Helden sind keine. Vielmehr dümpelt das Leben von Matthias Zschokkes Figuren auf Sparflamme vor sich hin; in kleinen Mietwohnungen, mit kleinen Jobs und auf kleine Ziele hin. Das mag alles in allem zunächst, nun ja, etwas kleinmütig klingen, doch der in Berlin lebende Schweizer ist ein Autor mit Talent für eben dieses Kleine. Er betrachtet es mit ernsthaftem, liebevollem Blick, und plötzlich zeigt sich dar in – wie bei einem Blick in das Mikroskop – eine ungeahnte Struktur, eine Bedeutung, sogar ein ganzes Leben, von dem man vorher keine Ahnung hatte.
Das war schon in seinem bezaubernden Buch «Maurice mit Huhn» (2006) so und ist in seinem neuen Roman «Der Mann mit den zwei Augen» vielleicht noch etwas ausgeprägter, wie die Liebe des Protagonisten zu einem alten Spitzer zeigt: «Die Maschine wuchs ihm ans Herz, obwohl sie aus Altersgründen nicht mehr ganz rund lief. Er mochte es, die Stifte ins Loch zu stecken und sie von den zwei mit Zähnchen bewehrten Backen packen und vom Federmechanismus in den Rachen mit der Messerwalze hineinziehen zu lassen. (…) Das Geräusch gefiel ihm, wenn sich die Walze mit der scharfen Stahlspirale um den Stift drehte und das Holz wegfrass. Der Duft von den frischen Holzlöckchen und dem Bleipulver war ihm angenehm, und er fuhr mit den Fingern gern über die winzigen Bisswunden an den Stiften, welche die Zähnchen hinterliessen.»
Für derlei Freuden und Freudchen lebt also der Protagonist von Zschokkes neuem Roman, den der Autor nur «den Mann mit den zwei Augen» nennt. Ein Mann also durchaus «mit Eigenschaften». Doch wer beherrscht schon die Kunst, mittels des Merkmals «zwei Augen» aus der Masse hervorzustechen? Kein Wunder, hält sich der Mann selbst für einen Langweiler. Auch sein Freundeskreis – der gerade mal aus einem desillusionierten Freund besteht – oder sein Liebesleben machen aus ihm keinen tollkühnen Helden: Seit nunmehr dreissig Jahren lebt er gemeinsam mit, oder vielmehr neben einer Frau.
Und man ahnt es: Beide schweigen lieber, als grosse Töne zu spucken. Sie von Natur aus, und er, weil er den Satz aufgeschnappt hat: Wenn das, was man zu sagen hat, nicht schöner klingt als die Stille, dann soll man lieber schweigen. «Der Mann mit den zwei Augen brachte es von jenem Tag an kaum noch über sich, mehr als zwei, drei Sätze zu sagen. (…) Da die Frau, mit der er zusammen in der Wohnung lebte, ebenfalls lieber schwieg als redete, kehrte in ihren vier Wänden himmlische Ruhe ein.»
Himmlische Ruhe hin oder her. Meist ist den beiden unwohl in ihrer ohnehin dünnen Haut, und sie stolpern durchs Leben – einander geradewegs in die Arme. Manchmal wirken sie dabei, als wären sie aus einer Inszenierung von Christoph Marthaler davongelaufen und hätten in diesem Roman ein neues Zuhause gefunden. Ihr Durch-das-Leben-Stolpern zeichnet Matthias Zschokke nun allerdings mit geradezu traumwandlerischer Sprachmacht. Und wenn er virtuos auf der Klaviatur seines Wortschatzes spielt, trifft er noch die feinsten Zwischentöne.
Die Frage, ob die einsame Gemeinsamkeit tatsächlich der Wunsch seiner Figuren ist, lässt der Autor indes genauso in der Schwebe, wie jene, warum die Frau zu einer Kur fährt, wo sie sich eines Nachmittags plötzlich das Leben nimmt. So rücken die grossen Zusammenhänge in den Hintergrund. Stattdessen regieren das Kleine und der eigenwillige Blickwinkel, den vor allem die Figuren einnehmen, wenn sie mit kindlicher Unbedarftheit die Schranken «normalen Handelns» verlassen oder Gedanken aussprechen, die man sich üblicherweise verkneift. Leider verlieren die liebenswerten Schrullen von Matthias Zschokkes Personal, wie man sie noch aus «Maurice mit Huhn» kennt, im neuen Buch etwas von ihrem Charme und wachsen sich zu geradezu Thomas Bernhard’scher Besessenheit aus.
Wenn also «der Mann mit den zwei Augen» nach dem Tod seiner Lebensgefährtin versucht, anderswo ein neues Leben zu beginnen, kann das Vorhaben nur misslingen. Selbst als er sich zum Schluss erhängen will, scheitert sein Entschluss an den alles bestimmenden Kleinigkeiten. Nämlich daran, dass er keinen passenden Menschen findet, der seinen toten Körper abhängen könnte, ohne dass ihm der hässliche Anblick den Tag vergällte. Und dafür muss man ihn einfach mögen.
"Der Sonntag / MLZ", Aarau, 19.08.2012

Armes kleines Insektenleben
Roman«Der Mann mit den zwei Augen» ist ein Hymne ans Mittelmass. Der gebürtige Berner Matthias Zschokke
seziert in seinem neuen Buch das ganz normale Leben. Und gewinnt ihm zuletzt doch etwas Tröstliches ab.
Anne-Sophie Scholl
«Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit», lässt Matthias Zschokke einen Schauspieler aus Harenberg auf einer Berliner Bühne
den Philosophen Nietzsche zitieren. Während Nietzsche seinen Ideen selbstbewusst philosophische Sprengkraft zuschrieb,
bringt Zschokke in seinem neuen Buch «Der Mann mit den zwei Augen» die Welt zum Implodieren. Zwei Augen, eine Nase
und einen Mund hat sein Held, das ist alles, was es über ihn zu sagen gibt. Er ist durchsichtig und so austauschbar wie die
situativ wechselnden Namen, die er annimmt. Sich selbst beschreibt er als sandfarben. Und die Frau an seiner Seite könne
man sich «am besten auch gleich sandfarben vorstellen».
Übermass an Mittelmass
Die jedoch ist zu Beginn des Buches schon tot, «freiwillig aus dem Leben geschieden», mit der Auflage, die Behörden sollten
ihre Leiche stillschweigend entsorgen: «Niemandem, der in irgendeinem Verhältnis zu ihr stehe, dürften ihretwegen jemals
Umstände entstehen». Möglichst wenig Umstände möchte auch der Mann machen, wenn er es ihr gleichtun und sich selbst
ganz zum Verschwinden bringen will, in Harenberg, jenem Dorf, wo ihn niemand kennt und wohin er mit seinem letzten Geld
gezogen ist. Dazwischen jedoch lässt ihn sein Autor noch einmal durch sein ganzes Leben taumeln, auf einer assoziativen
Gedankenreise, deren Pole da sind: das Übermass an Mittelmass und die mindestens ebenso grosse Sehnsucht, nicht darin
zu ertrinken.
Keine «Emotionspigmente»
Eine feine, gewitzte Selbstironie, der es jedoch nicht immer gelingt, sich auf die richtige Seite zu schlagen und die zuweilen
viel Weltschmerz durchklingen lässt, kennzeichnet den Stil des Autors, der 1954 in Bern geboren wurde, in Berlin lebt und mit
dem Roman «Maurice mit Huhn» 2006 einen Erfolg feiern konnte. Wie in seinem letztem Buch «Lieber Niels», das über 700
Seiten Mails an einen Freund versammelt, besticht die Ehrlichkeit der Beobachtungen und Selbstbeobachtungen. Wenn die
Frau etwa den sprachphilosophischen Ergüssen des Mannes über inhaltsleere Worte und das Leben ganz allgemein ihre
problematisch-pragmatische Entscheidungsfindung über das richtige Rot des Nagellacks entgegenhält, hat sie die Sympathie
zweifelsohne auf ihrer Seite. Und doch ziehen sich die gut 200 Seiten formloser Redseligkeit über die Ereignislosigkeit und
fehlenden «Emotionspigmente» in die Länge. «Damit müssen wir leben: Wir haben keine Bestimmung, keine Haltung, kein
Schicksal», versucht Rosaura, Bardame in einem zweifelhaften Etablissement, den Mann zu trösten. «So ein Insektenleben
fristen Sie und ich. Gehen Sie deswegen besser weg, wenn jemand Sie fragt, was Ihr Leben für einen Zweck gehabt habe,
was für einen Ziel, was für einen Sinn. Und bemühen Sie sich stets, sich selbst wichtig zu bleiben.»
"Berner Zeitung"/"Thuner Tagblatt", 16.8.2o12

Abseits des Alltäglichen
Ja, was denn nun? Ist´s eine Satire, gar eine schwarze Satire, was in den vergangenen beiden Tagen gelesen wurde? Was ist eine schwarze Satire? Ist das der Roman "Der Mann mit den zwei Augen"? Das neue Buch des Schweizers Matthias Zschokke, der vor Jahrzehnten in Berlin sesshaft wurde. Schnell, nachdem der Schriftsteller seine Leser 2009 mit dem mehrfach überraschenden E-Mail-Roman "Lieber Niels" beeindruckt hat. Zschokke ist kein Vielschreiber. Er ist kein Vielsager, kein Allessager. So viel er auch in "Lieber Niels" sagte, weil er was zu sagen wusste. Mit dem Sinn für Leichtigkeit, Witz und Gescheitheit. War Zschokke je ein direkterer, offenerer, sich öffnender, offenbarender Matthias Zschokke? Der ist er nicht als Autor des Romans "Der Mann mit den zwei Augen". Muss er auch nicht. Literatur ist die zweite Wirklichkeit des Lebens und somit eine eigene Wirklichkeit. Also fiktive Realität, die meist ihren Ursprung in der Realität hat.
"Der Mann mit den zwei Augen" ist das neue Erzählwerk des Epikers Zschokke. Der Mann ohne Namen, von dem die Rede ist, ist nicht der Zwilling des Erzählers. Nicht abwegig ist, ihn einen Engvertrauten des Verfassers zu nennen. Das rechtfertigt auch der Romantitel, der Neugierige, Interessierte zunächst einmal stutzig machen muss. Ist das nicht das Selbstverständliche wie Normale, dass der Mensch ein Zweiäugiger ist? Nachdenklich geworden, weiß man zugleich, wie häufig den Zweiäugigen Einäugigkeit vorgeworfen wird. Im Sinne des Erzählers ist das zweite Auge das des Fühlenden. Das Auge, das hinter dem Sichtbaren das Unsichtbare erkennen lässt. Das Auge dessen, der erschaut, was die Sehenden sehenden Auges übersehen. Also ist klar, mit was für einem Mann es die Leser des Romans zu tun bekommen?
Von dem "Mann mit den zwei Augen", der der Mehrseher ist, gibt´s nicht all zu viel zu sehen. Er ist keiner, der durch heroisches Handeln fesselt und so an den Roman. Im Grunde ist der permanent-pubertäre Mann mittleren Alters, ein Bruder des Jungmanns, der auf dem Titelumschlag abgebildet ist. Den beschreibt der Erzähler wie folgt: "Er ... sehnt sich nach einer sonnenbeschiedenen Wiese, auf die er sich rücklings hätte legen mögen, mitten ins warme Gras, unter einem Apfelbaum am liebsten, die Hände überm Bauch gefaltet, den Blick verloren im Blau des Sommernachmittagshimmels". Einer, der sich wegsehnt von dem, was ihm widerfährt. Also ab ins Abseits? Nicht ins Abseitige. Ins Absurde. Ins Irrationale. Aber ein bisschen abseits des allgemeinen Alltäglichen? Wäre schon schön. So gerichtet und ausgerichtet, lässt sich´s leben für den Mann. Ohne ein leichtes, leichtfertiges Leben zu leben. So existiert kein Protz. Kein Durchreißer. Kein Auffälliger. Eher einer, der leicht zu verwechseln ist. Alltagsmensch, der das Unalltägliche liebt. Nichts Ungewöhnliches im Gewöhnlichen also. Ein Normaler, dem gar nichts daran liegt, ein Normaler zu sein. Was ist das Normale?
Ist´s das Normale, binnen vierundzwanzig Stunden zwei Tode hinzunehmen? Für den "Mann mit den zwei Augen" ist das zu Beginn des Romans die Normalität. Es sterben eine Katze und ihre Besitzerin: "Die Frau mit der er zusammen in derselben Wohnung lebt", wie es wenig variiert wieder und wieder heißt. Die Frau, mit der der Mann rund dreißig Jahre in der gemeinsamen Wohnung wohnte. Donnerwetter, wenn das keine außerordentliche, ungewöhnliche Geschichte ist. Sofern das die Geschichte des Romans ist. Mehr Geschichte gibt´s nicht. Geschichten schon. Ist die Geschichte eine Liebesgeschichte? Eine schwarze gar? Etwa eine makabere? Manches mag manchem so erscheinen. Eine besondere Liebesgeschichte der besonderen Art ist´s schon. Die Geschichte zweier Solisten, deren Sein solistisch ist. Die so "werden, was wir sind". Wie wir alle, die wir solistische Wesen sind? Fragezeichen! Sich darauf einigen, dass Matthias Zschokke abermals vom "werden, was wir sind" erzählt? Was wird werden mit dem Werden, wenn man das Werdenwollen nicht im Sinn hat? Für den Mann mit den zwei Augen, für die Frau "in derselben Wohnung"? Ein Paar: in der Zeit, außer der Zeit. Nicht mitgerissen von der beschleunigten Zeit. Das Buch ist voll der Besinnungen auf die Entschleunigung der Zeit. Ist voll der Gedanken des Abschiednehmens, des nachlassenden Lebens, des sich nähernden Sterbens. Das bedeutet, stets bereit zu sein für die Stille in der lärmenden Welt. Sich also vorstellen, dass die Vorstellung vom Erleben auch ein Erleben ist. Stärker noch als das Erleben?
Das Geschehen in "Der Mann mit den zwei Augen" ist kein weltbewegendes Geschehen. Außer, es wird alles, was geschieht, als etwas gesehen, was die Welt bewegt. Und sei´s nur unmerklich. Ist das vermeintlich Unmerkliche nicht das Eigentliche, weil es die wesentlichen Momente des Lebens sind? Das ist wohl so. Zumindest für Matthias Zschokke. Also des Erzählens wert und wichtig. Im Rhythmus des gleichmäßigen auf- und abschwellenden Tons seiner Erzählweise. Die hat die magnetische Sprachkraft, die die Leser am Roman hält. Was gärt in den Texten des Romans "Der Mann mit den zwei Augen", gärt hinter den Texten. Das spürt, wer mit dem zweiten Auge liest.
Bernd Heimberger,"literaturmarkt.info", Frankfurt, 13.08.2012

Pendu ou marié à la fin de l’année
Un homme reconstruit sa vie. Matthias Zschokke, candide et serein
Pierre Deshusses
Harenberg a des vertus
apaisantes. C’est ce
que lui a dit la femme
avec qui il vivait: «Si
un jour il se sentait au bout du
rouleau, il devait se rendre en
train à Harenberg (…) ; il trouverait
là plusieurs hôtels situés côte
à côte où il faisait bon se reposer.
»Et du repos, il en a bien
besoin: celle qui lui a donné ce
conseil s’est suicidée, son vieux
chat est mort, il a perdu son dernier
ami ainsi que son travail de
chroniqueur judiciaire qui lui
permettait de vivre tant bien que
mal. Plus rien ne le retenant dans
la grande ville où il a vécu pendant
des décennies, il suit le conseil
de la femme qui n’a pas de
nom, comme lui, l’homme en
question, n’a pas de vrai nom
non plus (juste une fois, un simple
Bob) mais une épithète aussi
homérique que récursive, mais
guère distinctive: «l’homme
aux deux yeux», qui donne son
titre au roman de Matthias
Zschokke.
Or, quand il arrive à Harenberg,
en Basse-Saxe, ce qui l’attend ne
correspond en rien à ce qu’il était
en droit d’imaginer: pas de petite
ville pittoresque nichée dans une
nature verdoyante, mais une
sorte de cité-dortoir construite en
bordure de voie ferrée, avec quelques
bars glauques. C’est tout. Ce
qui pourrait être le terminus-suicide
pour certains devient pour
L’homme aux deux yeux une
sorte de case départ, car, si les
catastrophes peuvent détruire
une vie, elles peuvent aussi, dans
quelques cas, l’approfondir.
Comme les effets de certaines
drogues qui ne transforment pas
la personnalité mais exacerbent
ses traits dominants. Certain, désormais,
d’être un homme fade et
ennuyeux – l’homme aux deux
yeux n’a même pas la singularité
d’être borgne ou aveugle –, il se
compare à un tapir, incarnation
«à ses yeux» du manque total de
grâce. Mais voilà tout.
Questions incongrues
Il y a du Bartleby et du Plume
dans l’homme aux deux yeux, du
K. de Kafka aussi. Si la littérature
depuis Montesquieu n’a pas été
avare de ce genre d’individu, le
style et la finesse de Zschokke, à
qui l’on doit de singuliers romans
comme Max ou Bonheur flottant
(tous deux chez Zoé), le distinguent
des imitations. Lui qui n’a
jamais beaucoup parlé, parce
qu’il considérait sa vie comme
trop banale, devient l’habitué
d’un bar interlope dont la propriétaire,
lors de leur première
rencontre, l’a d’abord copieusement
invectivé et jeté dehors,
avant de devenir son amante
d’un jour. La confiance des corps
aidant, il n’hésite pas désormais à
poser à cette femme nommée
Rosaura les questions les plus incongrues,
n’esquivant rien,
comme si les mots «interdit»,
«convenances», «habitude»
n’existaient plus: «Pourriez-vous
éventuellement m’aider dans ma
tentative de produire un effet
moins ennuyeux sur les autres ?»
ou bien: «Vous n’auriez pas dans
votre cercle de connaissances un
jeune homme qui s’y connaisse en
pratiques sodomistes?»
Parce que tous les sujets sont
abordés avec naturel et candeur,
il y a quelque chose de sereinement
enfantin dans ce livre qui
coule comme une cascade, sans
numérotation de chapitre. Quelque
chose d’enfantin et de médiéval,
rappelant ces fabliaux où
l’évidence du temps présent installe
les personnages dans un réel
chaque fois renouvelé. Tenté un
moment par la pendaison,
l’homme aux deux yeux voit le
bon sens de Rosaura ramener ses
deux pieds sur la terre ferme. «Et
c’est ainsi qu’ils vivotèrent.» Tels
sont les (presque) derniers mots
du roman, qui révèle beaucoup
d’autres surprises.
L’homme qui avait deux yeux
(Der Mann mit den zwei Augen),
de Matthias Zschokke,
traduit de l’allemand (Suisse) par
Patricia Zurcher, Zoé, 256 p., 20 €.
"Le Monde", Paris, 9.1.2o15

Matthias Zschokke, le rire salvateur
Lisbeth Koutchoumoff
Dans «L’Homme qui avait deux yeux», le Biennois dégonfle les boursouflures contemporaines. Un roman à l’humour absurde, Prix fédéral 2012, qui fera date
S’il fallait un roman pour dégonfler les boursouflures contemporaines, les postures égomaniaques, les appels au sacrifice, s’il fallait un livre pour questionner le langage et les discours, tous les discours (populistes, médicaux, financiers, juridiques), s’il fallait une fable pour louer le silence, s’il fallait un conte pour rire dans la débâcle, ce serait L’Homme qui avait deux yeux, le nouveau roman du Bernois Matthias Zschokke.
Depuis Max, en 1988, Matthias Zschokke emprunte des sentiers à part, discrets, loin des autoroutes formelles. Sur ces chemins, il s’arrête souvent pour observer des détails à première vue insignifiants, qui racontent pourtant plus que n’importe quel plan large ou n’importe quelle explication. De là sa parenté avec Robert Walser, grand observateur des tessons du réel.
Que ce soit dans ses romans, dans ses pièces de théâtre, ses récits de voyage ou sa correspondance, ses personnages (ou lui-même) flottent, tanguent, clowns tristes qui affrontent avec rigueur le train-train quotidien tout comme les ballottements du monde. En voyage, Matthias Zschokke se met en scène en regardeur étonné, questionnant sans cesse les habitudes, qu’il s’agisse de son quartier à Berlin ou d’une plage à l’autre bout du monde. Dans ses romans, ses personnages sont des voyageurs dans leur propre vie. Dans une visite guidée, ils seraient les premiers à prendre la tangente, à se perdre. Ou alors à bombarder le guide de questions insolubles avec beaucoup de détails. C’est quoi, vivre?
L’Homme qui avait deux yeux est le pendant, tout aussi drôle mais plus sombre, plus apaisé aussi, de Maurice à la poule qui avait valu à Matthias Zschokke le Prix Femina étranger en 2009. Maurice conservait une part d’enfance. L’Homme aux deux yeux pourrait être Maurice mais bien plus tard. Le livre s’ouvre sur la mort (forcément inopinée, loufoque, pleine d’une grâce d’opéra italien) de la femme avec qui l’Homme aux deux yeux vit depuis plusieurs décennies.
Qui est ce veuf sans nom? Un homme globalement très déprimé à qui il arrive des choses très drôles. Comme le titre l’indique, il est à la fois banal et hors norme. Ou plutôt, sa banalité extrême en fait un être à part. Il est à ce point comme les autres qu’il se fond dans le paysage. Cheveux et vêtements couleur sable, il présente un visage si peu distinctif que tout le monde le prend pour un autre. Mis à part cette fadeur apparente, l’Homme aux deux yeux est très actif dans l’inaction, très parlant dans le silence et très loquace quand il décide de parler, c’est-à-dire rarement. Croisement entre un clown et un philosophe, il pose des questions frontales sur le sexe, le travail, l’économie, la vie, le suicide, la vérité, les mots, l’amour, la justice. Quand il s’emballe un peu trop, «la femme qui vit avec lui dans le même appartement», lui lance: «Comme le monde est profond. Je crois qu’il vaut mieux ne pas trop en parler.»
Comme Maurice, l’Homme aux deux yeux bute contre le monde comme un oiseau contre une vitre. Maurice ne cessait de tester deux approches: trouver un gouvernail à sa vie ou se fondre dans le mouvement comme l’eau dans un torrent? Au travers d’une immense fatigue pour tous les rituels sociaux (Nouvel An, dîners entre amis en tête), l’Homme aux deux yeux est toujours tiraillé par les questions existentielles («il réfléchit jour après jour à la vie dans laquelle il a été jeté»). Il a néanmoins dépassé toute idée de destin. En proie au chagrin, il se réfugie dans une petite ville, Harenberg, recommandée par «la femme avec qui il vivait dans le même appartement» comme étant un lieu capable de chasser les idées noires.
L’arrivée, au tout début du livre, de l’Homme aux deux yeux dans la bourgade sinistre, est un morceau d’anthologie. Pour ne pas gâcher le plaisir de lecture, on se bornera à évoquer l’entrée de notre homme dans un bar à prostituées. Il arbore une improbable coupe de cheveux réalisée juste avant de prendre le train. Alors qu’il n’a jamais mis les pieds à Harenberg et a fortiori dans ce bar, les habitués présents l’apostrophent tout de go: «Espèce de salopard. Alors comme ça, tu veux revenir chez nous à présent et bouffer nos patates? Sans les avoir plantées et sans les avoir récoltées? […] Mais ce n’est pas si simple mon ami. On le sait nous-mêmes, comme c’est joli chez nous. Ce n’est pas pour rien que Harenberg est appelée la Kiev de l’Ouest, qui passe à son tour pour être la Jérusalem de l’Est.» L’Homme aux deux yeux se défend: «Je ne suis jamais venu ici, comme je l’ai déjà expliqué à la dame qui se tient derrière le bar. Cela m’arrive constamment que l’on me confonde. C’est que mon visage n’est pas particulièrement facile à se rappeler. Se peut-il que vous me preniez pour un coiffeur nommé Türschmidt? Je me suis fait couper les cheveux par lui juste avant de partir. C’est lui qui m’a infligé cette drôle de coiffure de page, exactement la même que la sienne.» L’explication n’aura aucun effet sur l’ire des buveurs.
L’homme aux deux yeux ne bougera plus de Harenberg. Déroulant mentalement sa vie, il déploiera aussi sa rencontre avec la femme qu’il a, en fin de compte, aimée. Le couple s’aime au cœur du train-train, sans mots, sans phrases, s’en méfiant même, comme on l’a vu. Se préparer à manger, regarder ensemble par la fenêtre, lire en silence en hochant la tête, tels sont les sommets de leur histoire. Il en est un autre peut-être, celui où l’homme regarde la femme dormir.
Face aux médecins qui tranchent au lieu de soigner, face aux propriétaires avides, face aux adeptes du régime alimentaire préhistorique, face aux juges qui ne font pas la différence entre justice et sentiment de justice, l’Homme aux deux yeux écrit des lettres, tempête, observe. Sans le sou, il se montre très pragmatique. Il acceptera de devenir membre d’une loge maçonnique dans l’espoir de toucher le pactole. La scène, sur plusieurs pages, est un autre sommet d’humour absurde.
Rosaura est la dame qui sert au bar de Harenberg. Elle joue un rôle important. C’est elle qui écoute les interrogations sexuelles de l’Homme aux deux yeux ainsi que ses projets d’en finir. «Je préférerais ne pas continuer.» Le sens de la vie? Rosaura ne s’en laisse pas conter. Elle aura le mot de la fin.
"Le Temps", Genève, 17.1.2o15

Epopée d’un homme ordinaire
Anne Pitteloud
«L’HOMME QUI AVAIT DEUX YEUX» Après la perte de sa femme, l’antihéros de Matthias Zschokke tente de démarrer une nouvelle vie dans une ville inconnue. Une errance insolite, entre cafard et légèreté.
A l’heure des grandes manifestations, des déclarations solennelles et des sentiments exacerbés, évoquer un roman de Matthias Zschokke propulse aussitôt dans l’infime et la dérision, dans un monde en ton mineur, aussi incertain que ses héros traversés de doutes existentiels et d’un intense sentiment d’absurdité. On retrouve ainsi dans L’Homme qui avait deux yeux (Prix fédéral de littérature 2012), son dernier roman traduit en français, le ton inimitable de l’écrivain alémanique parfois comparé à Robert Walser. Ici, il met en scène un homme que rien ne distingue. Deux yeux, des vêtements de couleur sable, comme ses cheveux et sa mallette, ce chroniqueur judiciaire partage depuis trente ans son appartement avec la même femme, qu’il vouvoie toujours. C’est après sa mort qu’il réalise qu’il l’aimait sans doute. Il faut dire qu’elle préférait se taire, et qu’il ne la connaissait pas très bien. On suit donc l’équipée drôle et désabusée de cet homme endeuillé qui tente de prendre un nouveau départ.
Le ton est donné dès l’ouverture. Alors qu’il lui téléphone à la clinique pour lui annoncer la mort de sa chatte de 21 ans, elle répond bizarrement en italien «io dormo, io dormo», avant de raccrocher. Ce seront ses dernières paroles: elle se suicide pendant la nuit. «Avec les années, il s’était habitué à cette femme. Il aimait flâner dans les rues en marchant à sa gauche et en la tenant par la main. Mais alors, il ne trouvait généralement rien à lui dire. Comme la paix et le bonheur, ils n’avaient tous deux pas trop de mots et d’histoires à disposition.»
L'INCONGRUITE DU QUOTIDIEN
C’est ainsi que se développe un récit tissé de petits riens – «Parfois, je suis convaincu que ma crainte d’être un raseur est moins liée à un manque de vécu qu’au fait que je ne comprends pas que tout ce que l’on a vécu possède la même valeur», dit l’homme. Matthias Zschokke déplie les situations banales jusqu’à mettre à nu leur aspect insolite, comme si, à force d’attention, se dévoilait toute l’incongruité du quotidien. C’est d’ailleurs la force et la charge comique de cette prose faussement naïve. En s’attachant aux faits vécus par son héros si banal et pourtant si peu conforme, en suivant la pensée digressive de cet énergumène en constant décalage avec les autres et le monde, l’auteur éclaire le revers des choses, leur extraordinaire étrangeté, et la solitude de chacun. L’apparent détachement du protagoniste, ses envolées philosophiques, ses révoltes prosaïques ou existentielles, son chagrin à peine formulé, suscitent autant le sourire que l’émotion. Truffé de scènes tragicomiques et de dialogues inattendus, L’Homme qui avait deux yeux est ainsi dans le même temps un roman d’aventures plein d’humour et une méditation sur un monde dénué de sens.
Qui est-il, cet homme aux deux yeux? C’est la question que lui-même se pose. Après la perte de sa femme, de sa chatte, de son travail et de son appartement, il quitte Berlin où les loyers deviennent outranciers. A 56 ans, notre héros veut repartir de zéro, mais tout d’abord se reposer à Harenberg, dont la femme lui avait parlé comme d’un havre de paix. Or la ville se révèle une banlieue sans charme, et l’homme couleur sable échoue dans un bar où on le prend pour un autre. D’ailleurs, à chacune de ses visites, la serveuse Rosaura l’accueille comme pour la première fois, ce qui lui permet de «respirer librement», lui confiera-t-il, et de tenter des expériences inédites.
Foisonnant d’anecdotes réjouissantes, le récit navigue entre sa quête harenbergoise désenchantée et ses souvenirs de la femme qui partagea son appartement. Leur rencontre même est cocasse: elle chante si faux, dans ce chœur dont il fait aussi partie, qu’il la remarque, la raccompagne, et finira par se frotter contre elle. Il est aussi question d’animaux, qu’il affectionne, d’invitations d’amis qui se terminent en queue de poisson, de l’achat quotidien du journal, de la vue depuis la fenêtre, de ses soucis d’argent et de ses idées pour en avoir... Régulièrement, il se lance dans des discours enfiévrés sur la philosophie du langage, la non-adéquation des mots aux choses ou l’impossible véritable création – «nous ne pouvons rien créer en allant le puiser à l’intérieur de nous-mêmes», seulement donner forme à ce qui se crée et se pense soi-même. La femme l’écoute silencieuse et, quand il attend une réponse, finit par prononcer des phrases du genre: «Ma tête exige que je la nourrisse, mon ventre, lui, veut des saucisses.» Une sentence lue sur le calendrier des chiens suspendu à la cuisine, explique-t-elle devant son air ahuri.
Son silence à elle flotte entre eux, aura invisible autour d’une présence légère comme un souffle. Pas question de l’interroger sur elle-même, et c’est dans ce mystère intact qu’ils vivront côte à côte un quotidien rythmé de rituels et de moments heureux. Est-ce à cause de lui qu’elle a voulu mourir? Car ce sont les proches qui, «sans le vouloir», font «des trous dans les coquilles d’espoir que chacun construit autour de soi pour pouvoir, à l’intérieur d’elles, se laisser dériver vers l’avenir tout en restant à peu près sec».
AGITATION INSENSEE
Désemparé, l’homme aux deux yeux ne s’intègre pas à Harenberg. La prose légère et lumineuse de Zschokke est ourlée d’ombre, et derrière l’étrangeté du regard pointent la tristesse et l’envie d’en finir. Loin d’être déconnecté du monde, L’Homme qui avait deux yeux questionne son agitation insensée. A la lecture du Harenberger Tageblatt, l’homme «s’aperçut qu’il comprenait de moins en moins toutes ces convictions que l’on défendait autour de lui», avec ardeur, dans les médias et les cafés. A cette effervescence, il oppose sa solitude et la quête impossible d’un lien qui fasse sens.
C’est alors seulement, à la fin du récit, que Matthias Zschokke lui donne un nom – «pour plus de commodité, il s’appellera Philibert jusqu’à nouvel ordre» –, comme s’il s’incarnait enfin au moment où il prend conscience qu’il ne sait pas «être là, simplement». Et on savoure une fin qui, loin des grandes questions existentielles, voit le triomphe du quotidien, avec ses gestes prosaïques, sa sagesse répétitive et, surtout, une présence amie.
"Le Courrier", Genève, 17.1.2o15